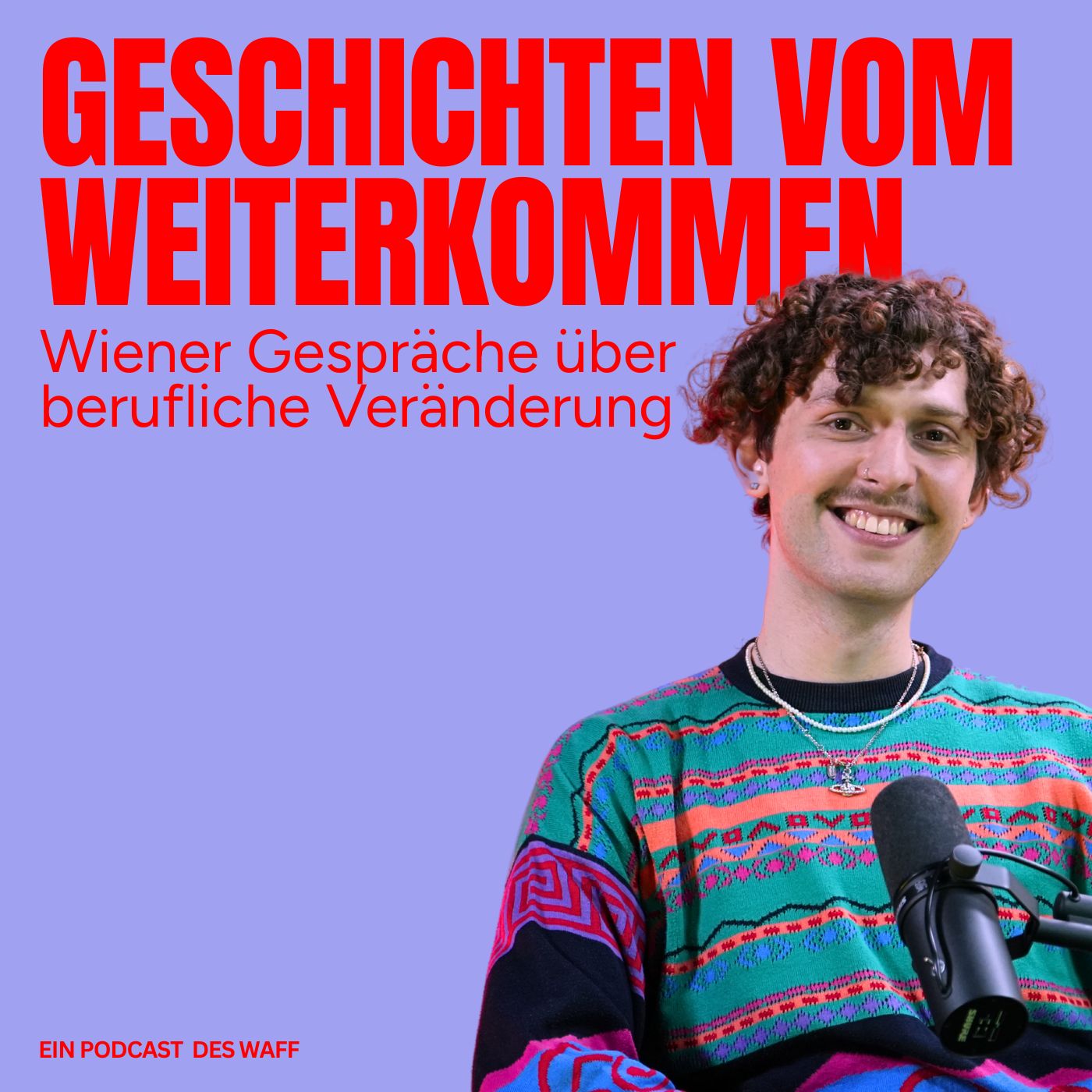Stadt Wien Podcast
Stadt Wien Podcast
Warum gehen so wenige Männer in Väterkarenz, Erich Lehner?
Nur 16 Prozent der Väter gehen in Österreich in Karenz. Warum ist das so? Christine Oberdorfer spricht mit dem Männlichkeitsforscher Erich Lehner über die historischen Wurzeln von Geschlechterrollen, die Bedeutung sorgender Männlichkeit und was es braucht, damit Väter stärker in die Care-Arbeit eingebunden werden.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert (falls ihr das noch nicht gemacht habt).
Feedback könnt ihr uns auch an podcast(at)ma53.wien.gv.at schicken.
Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen:
https://www.facebook.com/wien.at
https://bsky.app/profile/wien.gv.at
https://twitter.com/Stadt_Wien
https://www.linkedin.com/company/city-of-vienna/
https://www.instagram.com/stadtwien/
Und abonniert unseren täglichen Newsletter:
http://wien.gv.at/meinwienheute
Weitere Stadt Wien Podcasts:
- Historisches aus den Wiener Bezirken in den Grätzlgeschichten
- büchereicast der Stadt Wien Büchereien
-Herzlich Willkommen bei einem neuen Stadt Wien Podcast. Vater sein heißt, Verantwortung zu teilen. Doch noch immer übernehmen viele Männer diesen Teil kaum. Warum fällt Gleichberechtigung in der Familie so schwer? Und was braucht es, damit Care-Arbeit selbstverständlich wird? Für alle. Darüber spricht Christine Oberdorfer mit ihrem Gast.-16 Prozent der österreichischen Väter gehen in Karenz, damit sind wir das Schlusslicht in der EU. Und nur ein Prozent der Väter ist länger als sechs Monate beim Kind. Soweit die Zahlen, für die wir heute eine Erklärung suchen in der Geschichte, in den gesellschaftlichen und in den politischen Strukturen. Zu Gast bei mir ist der Männlichkeitsforscher Erich Lehner. Danke für den Besuch im Studio.-Gerne, danke für die Einladung.-Sie arbeiten in der Männlichkeits- und Geschlechterforschung, was heißt das denn?-Ja, die Männlichkeits- und Geschlechterforschung ist eigentlich eine Reaktion auf den Feminismus, wo Frauen sozusagen zunächst einmal hingewiesen haben, dass es so ist, dass es wie ein Geschlecht gibt, aus ihrer untergeordneten Position, und wo sie sich auch mit Männern verständigt haben, sodass die Notwendigkeit für Männer entstanden ist, dieses Geschlechterverhältnis aus der männlichen Perspektive zu sehen und hier dementsprechende Forschungsprozesse in Gang zu setzen. Wichtig ist, dass diese Männer auch davon ausgehen, dass das Geschlechterverhältnis ein hierarchisches ist und das auch die Grundlage ist für alle Forschungen und alle Reflexionen, die in diese Richtung gehen. Es geht immer darum, Gleichheit bzw. Gerechtigkeit zu schaffen.-Warum ist es wichtig, über die Rolle von Männern in der Gesellschaft zu sprechen? -Weil eben historisch gewachsen diese Rolle dermaßen ist, dass es hierarchisch ist. Dass Männer sozusage privilegiert sind. Und zwar nicht im Einzelfall immer, sondern in erster Linie als Gruppe, sodass wir sagen müssen, jeder Mann ist Angehöriger des mächtigeren Geschlechtes. Und das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für den Mann, natürlich für die Frau und hat Konsequenzen für die Kinder, für die gesamte Gesellschaft. Und die sind nicht positiv, diese Konsequenzen, sodass es besser ist für Männer, Frauen und Kinder und für alle in der Gesellschaft, wenn Gleichheit herrscht und auch für das Leben von Männern.-Wo kommen diese Bilder von Männlichkeit her? Konkurrenz, Wettbewerb, das sind ja lauter so typisch männliche Attribute. Ist das historisch gewachsen oder wo stehen wir heute und wo kommt das her?-Also für uns entscheidend, für die jetzige Zeit entscheidend, wäre sozusagen die Industrialisierung. Die bürgerliche Männlichkeit. Also in jene Zeit, wo dann der Mann hinausgeht in das Leben, in die Fabrik, in die Arbeit. Und zwar auf allen Arbeitsschichten. Der bürgerliche Mann war natürlich der Fabriksbesitzer, aber dementsprechend dann auch die Arbeiter. Wo es dazu kommt, dass sozusagen die Familie aufgeteilt wird in den Ernährer, den männlichen Ernährer und in die mütterliche Haushaltsführende. Und das ist eigentlich die krux für die derzeitige Situation. Insgesamt gesehen muss man schon auch sagen, wenn wir die Menschheitsgeschichte mit dem Homo sapiens beginnen, dann müssen wir sagen, dass der Patriarchat, wenn wir diese gesamte Menschheitsgeschichte auf 24 Stunden sozusagen aufteilen, dann ist der Patriarchat ungefähr vier bis fünf Minuten. Und das hat damit zu tun, dass wir ja lange, lange Zeit sozusagen partnerschaftlich gelebt haben und erst seit dem Neolithikum, also seit der Ackerbaukultur, sozusagen 5000 Jahre können wir jetzt sagen, so etwas gibt wie diese Trennung, nicht? Also heute, das ist so die große Dimension, wo wir klar sein müssen, längere Zeit und prägend war für die Menschheitsgeschichte eigentlich die Partnerschaftlichkeit. Und historisch entwickelt und für unsere Zeit, besonders seit der Industrialisierung, ist diese Trennung. Und das müssen wir wieder rückgängig machen.-Und diese Partnerschaftlichkeit, was meinen Sie damit? Das heißt, man hat sich die Arbeit aufgeteilt, einer war jagen, einer war sammeln oder wie stell ich mir das vor?-Nein. Beide waren jagen, beide waren sammeln, auch wenn der Schwerpunkt der Großwildjagd vielleicht eher bei den Männern war. Aber wichtig ist, dass sich beide partnerschaftlich gemacht haben. Wir können es anders sagen, beide haben ausgeglichenermaßen für die Existenz beigetragen, nicht? Und beide waren bei den Kindern. Entscheidend war genau dieser Punkt, dass in der Menschheitsgeschichte Kinder zu erziehen sind, zu versorgen sind. Und da gibt es historische Entwicklungen, dass das für beide Geschlechter notwendig war. Das war eigentlich die menschliche Entwicklung. Männer in Sorge war die Voraussetzung für die menschliche Entwicklung hin zum Homo sapiens.-Das heißt, heute stehen wir an einem Punkt, der jetzt eigentlich gar nicht so neu ist.-Genau. Der ist nur deshalb neu, weil die letzten Jahrhunderte und die letzten Jahrtausende, möglicherweise eher so in die Richtung der männlichen Dominanz gegangen sind. Aber auch historisch gesehen haben wir große Unterschiede in der Geschichte. Und es ist nicht immer nur gesagt, dass nur allein die Mutter zuständig ist.-Wo kommen dann diese männlichen Attribute her? Dieses Wettbewerbsverhalten, Dominanz, Konkurrenz. Wo kommen denn diese typisch männlichen Verhaltensweisen her, die wir immer so zu sehen glauben? Oder sehen?-Ja, historisch gesehen war der Schutz der Familie und dieses Ernähren der Familie sozusagen immer mit Männlichkeit konnotiert. Und damit haben wir so etwas, dass die Öffentlichkeit mehr oder weniger zur Sphäre des Mannes wird, der Männer wird. Und diese Männer halt jetzt in der Gruppe dann agieren. Hier kommt dann die Konkurrenz, der Wettbewerb. Hier kommt dann so das, was wir heute das traditionelle Männerbild bezeichnen in allen Familien präsent, wo es darum geht, dass man dem Buben sagt, er setzt dich durch oder so. Oder wenn der von der Schule kommt und sagt, er hat mich gekaut. Na ja, muss dich halt wehren oder so. Dieses Wehrhafte, was man zu Mädchen nicht so sagt. Aber sie merken hier sozusagen, dass hier diese traditionellen Bilder durchkommen. Und das ist in erster Linie Sozialisation. Und diese so sozialisierten Personen, die gehen dann natürlich in die Öffentlichkeit und prägen das. Gleichzeitig müssen wir immer sagen, daneben gibt es auch viele andere Männerbilder. Und nicht jeder Mann ist so wahnsinnig dominanzorientiert und dergleichen. Aber dennoch, jeder Mann, jede Frau in dieser Gesellschaft muss sich mit diesen Bildern auseinandersetzen. Und muss dann auch die Differenz sozusagen aushalten. Und es ist ein sozialer Prozess, der uns in diese Richtung bringt. Daher müssen wir auch, um dies abzubauen, soziale Prozesse initiieren, um eine partnerschaftliche Männlichkeit, wie wir sagen, eine sorgende Männlichkeit zu entwickeln. Also Männer zu stärken, die in ihrer Sorge tätig sind, sodass sich allmählich auch das Männlichkeitsbild verändert und viel mehr Männer in diese Richtung arbeiten.-Was heißt sorgende Männlichkeit?-Sorgende Männlichkeit, das wäre ein Bild, das in erster Linie Partnerschaftlichkeit, das Empathie forciert für andere Menschen und das vor allem ablehnt, dass es so etwas gibt wie Unterordnung. Unterordnung von Frauen, Unterordnung und Dominanz über Frauen ablehnt und auch Unterordnung und Dominanz über andere Männer. Das Problem ist ja, dass ja nicht nur allein Frauen abgewertet werden mit diesem Männlichkeitsbild, sondern das Problem besteht auch darin, dass sozusagen viele Männer abgewertet werden, dass es sozusagen diese Hierarchien unter Männern gibt, und dass wir hier abgestuft sind, sodass sich auch ein Großteil der Gewalt eigentlich unter Männern abspielt. Das ist sozusagen dieses Konkurrenzverhältnis. Und da müssen wir angreifen. Wir müssen auf der einen Seite eingreifen, dass wir sozusagen diese Bilder hinterfragen und damit Männern andere Entwicklungschancen geben, eben in Richtung Sorge, Empathie, und gleichzeitig müssen wir sozusagen dafür sorgen, dass Strukturen es gibt, dass Männer wirklich in dieser Tätigkeit gestärkt werden.-Kann was heißen in der Praxis, das heißt, was wären denn da Punkte, wo man ansetzen müsste, damit man in die Richtung kommt? Ich meine zuerst mal draufschauen, das ist glaube ich der erste Punkt, das mal erkennen.-Ich glaube, einer der entscheidenden Punkte ist, dass Männer in eine sorgende Tätigkeit kommen, gleich von Grund auf überall dort, wo es Kinder gibt, überall dort, wo es Menschen zu pflegen gibt, natürlich in der Familie. Und da sind wir dann sozusagen bei der halbe-halbe, innerhalb der Familie, sobald ein Kind kommt, dass männlich gelesene Menschen und weiblich gelesene Menschen sich zu gleichen Teilen um dieses Kind kümmern. Weil wir auch wissen, dass für Männer es am intensivsten zu lernen ist, Fürsorglichkeit, Partnerschaftlichkeit, wenn sie sich um Kinder kümmern. Und dass hier wirklich eine Quelle ist, um Männlichkeitsbilder zu verändern. Wir wissen, dass diese Männer, die sich um diese Sorge kümmern, auch dann andere Männlichkeiten entwickeln. Viel mehr sorgeorientiert, empathisch für die anderen und damit auch einen Sensus entwickeln, um empathisch für sich, für die anderen und für die Umwelt zu sein.-Aber die Rollen sind ja jetzt immer noch sehr, sehr ungleich verteilt. Wir haben es ja vorhin in der Einleitung schon gesagt, bei den Zahlen. Warum ist es denn so? Woran liegt es denn, dass immer noch so wenig Männer in dieser Vaterrolle aktiv sind?-Ich glaube oder meiner Meinung nach ist sozusagen das größte Versäumnis, dass wir die Strukturen nicht verändert haben. Die Strukturen der Arbeitswelt, wo wir auf der einen Seite zwar schon auf individueller geistiger Ebene diese Bilder von Partnerschaftlichkeit in der Gesellschaft haben, wo es Männer gibt, die auch mit Kinderwagen gehen, wo Männer gibt, die sozusagen das schon ablehnen und wirklich von ihrer Einstellung her auf Gleichstellung orientiert sind. Was aber fehlt in unseren Gesellschaften und wir können in Europa sagen, je weiter südlich, desto mehr. Wir sind da sehr, sehr traditionell jetzt. Was aber fehlt, ist sozusagen die Strukturen, die dies auch ermöglichen werden. Und zwar die Strukturen in der Arbeitswelt, in der Familienpolitik und dergleichen. Und da gehört gewaltig nachgeholt, dass wir sowohl Männer als auch Frauen in der Arbeitswelt fördern, dass die ihrem Beruf nachgehen und gleichzeitig beide Geschlechter, alle Geschlechter, es gibt ja Vielfalt, sozusagen dann auch diese sorgende Pflege in der Familie übernehmen oder in ihrem Umfeld übernehmen, wie man das dann organisiert ist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, der noch fehlt.-Das heißt die politischen Rahmenbedingungen. Könnte was heißen?-Das könnte heißen, ganz konkret, halbe-halbe bei Karenz beispielsweise. Also ich würde mir wünschen, dass die Karenzzeit aufgeteilt wird auf die Eltern und nach dem nordischen Modell use it or lose it, das heißt, wenn du es nicht verwendest, hat dein Kind weniger Karenzzeit eines Elternteils. Und danach natürlich dann Arbeitszeitregelungen. Nordische Länder haben zum Beispiel eine Teilzeitberechtigung und haben jederzeit das Recht, wieder auf Vollzeit zurückzugehen und natürlich dann Kindergärten und dergleichen. Also alle diese Maßnahmen, die wir eigentlich kennen, aber sehr, sehr gezielt auch auf Männer zugeschnitten, sodass Männer in diese Sorge kommen.-Das heißt, dieses use it or lose it würde dann heißen, jetzt Hausnummer keine Ahnung, ich habe zwölf Monate Karenz gemeinsam und jeder nimmt sechs Monate, wenn der Mann jetzt oder die Frau, wie auch immer, die sechs Monate nicht nimmt, dann verfallen die einfach.-Genau. Island hat das diesbezüglich beste Modell meines Erachtens, zwölf Monate, jeder sechs, und zwei kann man sich verschieben individuell, sodass vielleicht der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber grundsätzlich ist das die Grundnorm.-Und diese politischen Modelle, Sie haben jetzt schon die nordischen Länder genannt, ich habe gesehen Luxemburg, Finnland natürlich, ja und Slowenien ist auch so weit oben bei der Väterkarenz. Haben die auch so ein Modell?-Als wir können davon ausgehen, dass das eigentlich das Modell der EU ist. Die EU hat ja auch Österreich dazu gezwungen, mehr oder weniger, dass sie diese zwei Monate Karenz, als unabhängigen Anspruch des anderen Elternteils, das bewusst so definiert haben. Von daher, so ist es auch in Slowenien. Eigentlich müsste in jedem EU-Land es so sein, dass ein Teil der Karenz auf den Vater fällt. Ich würde mir nur wünschen, dass das klarer geschlechtergerecht durchgezogen wird und auch dann weiterhin, und das ist dann der nächste Schritt, in den Betrieben sozusagen, so aufgenommen wird, dass die Betriebe es ihren Mitarbeitern ermöglichen, ihrer Väterlichkeit nachzukommen.-Ich höre aber schon auch immer wieder von Männern, ich kann in meinem Job nicht in Karenz gehen, Frauen können natürlich, weil sie müssen, eh klar. Es geht also, aber warum ist das so, dass die Männer glauben, sie können nicht?-Weil das vermutlich der Chef sagt. Ich glaube aber schon, dass da im Hintergrund sozusagen, ein männliches System ist, das kein Interesse hat. Und hier kommt sozusagen auch mentalitätsmäßig Männlichkeit in den Vordergrund, dass da sagt, du bist für die Ernährung zuständig. Und zwar ist das nicht die Aussage einzelner Männer, vermutlich waren wir die Chefs, dann sagen die genauso, nein, nein, wollen wir eh, aber wir können doch nicht. Und es gibt natürlich welche, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Ja, weil das geht dann nicht. Aber wenn ich jetzt zurückschaue sozusagen und in den Projekten schaue, dann gibt es immer Spielraum, Handlungsmöglichkeiten. Vielleicht geht es nicht überall 50-50 oder so, aber es gibt Handlungsmöglichkeiten. Und das, was notwendig wäre, wäre, dass in der Arbeitswelt so eine Dynamik kommt, dass man bewusst sagt, wir müssen es den zweiten Elternteil ermöglichen, dass er genauso zu Hause präsent ist wie die Mutter.-Das hat das in die Führungskräfte auch gefragt. Die Stadt Wien als Arbeitgeberin ermutigt ja Männer dazu, die Karenz in Anspruch zu nehmen. Was sagen Sie denn Männern, die von sich aus das Gefühl haben, ich kann nicht weg, unmöglich?-Sie sollen mit ihren Kolleg*innen sprechen, mit den Vorgesetzten sprechen. Es geht natürlich schon so, dass wir in einer Übergangszeit sind. Und so Beispiele kenne ich schon. Natürlich kannst du Teilzeit gehen, aber die Arbeit wird dem nicht verringert. Es kommt nicht mehr Personal oder so. Und aus diesem Hintergrund verstehe ich subjektiv schon, dass mancher Mann sagt, das geht nicht. Ich arbeite dann mehr, aber mit weniger Geld zum Beispiel. Also wir müssen schon auch achten, dass da wirklich auch das System das aufnimmt. Ich muss, wenn jemand weniger Stunden anwesend ist, auch die Arbeit reduzieren und muss vielleicht mit einem anderen anstehen. Gleichzeitig, da kommt dann sofort der Arbeitskräftemangel, müssen wir Frauen, verstärkt ermutigen zu arbeiten. Und das Modell von Schweden ist ja nicht, dass Männer bei Kindern sind oder Frauen, sondern dass Eltern bei Kindern sind. Das Ideal wäre, dass beide auf Teilzeit gehen, solange es notwendig ist, nicht? Und dass beide sich das aufteilen, damit Kinder Eltern haben, nicht? Das wäre sozusagen der Fluchtpunkt, wo wir in Schweden sind oder wo wir in den nordischen Staaten sind. Die wollen nicht sozusagen die Frau stützen oder den Mann stützen, sondern Eltern, nicht? Das wäre das Ziel.-Das Ideal für die Kinder ist es wahrscheinlich auch, wenn sie beide Elternteile zur Hälfte haben. Wie profitieren Kinder davon?-Da gibt es viel wissenschaftliche Forschung, dass Kinder am meisten profitieren, wenn sie mehrere Bezugspersonen haben. Und die Minimalform der Bezugsperson sind Eltern. Und die möglichst ausgeglichen, sodass sie zu beiden Elternteilen eine gute Bindungsbeziehung haben. Und wir können schon sagen, für die Kindererziehung ist das traditionelle Modell, wo die Mutter zu Hause ist, alleine möglichst, und der Vater nie, fast nie, weil er arbeitet und so. Dieses Modell ist suboptimal. Das optimale Modell wäre schon, dass die Bezugspersonen mit den Kindern leben. Sie entwickeln sich besser, sie haben weniger psychische Probleme, sind in der Schule besser, haben größeren sozialen Sinn und haben auch eine flexibere Geschlechterrolle.-Dieses partnerschaftliche Ideal von Halbe-Halbe, das wird oft so vermittelt als ich tue meiner Frau einen Gefallen, ich mache das für meine Frau. Aber ist es nicht so, so wie Sie es vorhin auch schon angedeutet haben, dass es einfach tatsächlich für beide Geschlechter besser ist und dass beide davon profitieren?-Ja, das, was sie jetzt angesprochen hat, wird in der Forschung sozusagen Gehilfe genannt oder Praktikant oder so. Also wo sozusagen der eine Elternteil, also meistens der Mann, hilft, wenn du etwas sagst, mache ich es halt. Und das steckt auch hinter dieser derzeit großen Überlegung von Mental Load, wo eher Gehilfe ist. Nein. Was hier schon gemacht ist, was gedacht ist, Partnerschaftlichkeit ist, wo klare Aufgabengebiete aufgeteilt sind, wo Verantwortlichkeiten übernommen werden, wo beide Partner*innen sozusagen das wahrnehmen, was sie können, aber ausgeglichen. Und wenn wir jetzt wieder auf die Männer schauen, dann ist es ein irrsinniger Profit für die Männer, weil sie, wenn sie Beruf und Familie sozusagen matchen, also ausgeglichen bearbeiten, weil sie wesentlich gesünder sind, weil sie wesentlich weniger psychische Schwierigkeiten haben und weil die Partnerschaften besser werden. Auch wenn man sich trennt, ist es eine friedlichere Partnerschaft. Also das sind die Langzeitfolgen. Und was ganz entscheidend ist, es kommt zu einer immensen Reduktion von Gewalt. Also wir wissen, dass in Familien, wo beide sozusagen jetzt Gleichstellung leben, zunächst einmal auf der psychischen Ebene, also wer das letzte Wort hat, Kinder davon profitieren, dass dort weniger Gewalt an Kindern ist. Und dort, wo beide ausreichend zum Familieneinkommen beitragen, wo das Familieneinkommen auf beiden partnerschaftlich aufgeteilt ist, es zu weniger Gewalt in der Partnerschaft kommt. Dass das insgesamt sozusagen wirklich signifikante Reduktion von Gewalt ist.-Wie kriege ich es jetzt in der Familie zu diesem ausgeglichenen Verhältnis? Die Männer, die sagen, ich will gern, oder ist da auch die Frau gefragt, die dann sagen wird, das ist zu tun, setzen wir uns hin, teilen wir es uns auf?-Also es müssen alle beteiligt sein. Sowohl die Frauen als auch die Männer und die Strukturen. Beginnen sollte man sozusagen jetzt. Immer. Also dass sowohl Pflege, also zum Beispiel ein Kindergeburtstag, oder das Lernen mit den Kindern, oder Kinder zum Arzt bringen, Kinder pflegen, versorgen, für Kinder kochen, waschen, putzen. Also das muss aufgeteilt werden. Es ist nicht so effektiv, wenn der Papa nur ein Spielepapa ist, sondern wenn er wirklich Pflege übernehmen kann. Und das ist schon ein psychischer Prozess, weil die Kinder dann lernen, ja dem kann ich mich anvertrauen. Der Spielepapa ist mehr oder weniger jener Papa, der halt lustig ist und so. Aber dann geht man doch zum anderen Elternteil, wenn irgendeine Sorge ist und so. Echte Bindung, vertiefte Bindung, beginnt dort, wo ich auch Sorge übernehmen kann. Sowohl Spielen, das ist gut und so, aber auch Sorge. Daher ist es ganz, ganz fähig. Und das verändert wieder sozusagen bei den Männern Männlichkeitsmuster. Ich muss sozusagen eine angemessene Durchsetzungsfähigkeit entwickeln. Ich kann nicht einfach dominant reingehen und sagen, mach das. Sondern ich muss das Kind verstehen, ich muss Empathie machen und so weiter. Und das macht auch die andere Männlichkeit aus. Al la longue weniger Gewalt. Und so kommen wir sozusagen auf einer Beziehungsebene zur Partnerschaftlichkeit. Was für alle Menschen das Bessere ist. Und alle müssen daran teilhaben. Selbstverständlich auch die Frauen, die hier auch teilen. Ihren Bereich teilen, keine Frage. Aber auch Männer, die wieder ihren Bereich teilen.-Das heißt, die Frauen ein bisschen mehr fordern. Ich weiß es von mir. Ich glaube, das Fordern vergisst man oft auch ein bisschen. Gerade was die Kinderbetreuung betrifft.-Zum Beispiel, ja. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Männer sich engagieren, würde ich jetzt einmal sagen. Und sagen, hey, sich einmischen in Bezug auf eine positive Kinderbetreuung. Dinge übernehmen. Ich glaube dann, dass viele Frauen dann durchaus auch bereit wären zu teilen.-Glaube ich auch. Ja, aber natürlich, das ist dann schon ein gesellschaftliches Thema. Dass man sagt, als Mann, ich bin mir bewusst, dass ich das tun sollte. Und dass das von mir erwartet wird. Und dass es für mich auch gut ist. Und für meine Familie gut ist.-Absolut . Also ich habe vielen Frauen und Männern gesagt, wo die Frau sagt, na ja, ich will meine Mutterschaft. Und ich will das auf Karenz. Und das möchte ich für mich und so weiter. Und dann haben sie gesagt, und der Mann? Und da würde ich sagen, Männer, kämpft. Redet mit den Frauen von vornherein. Wir teilen das. Ich will immer dabei sein. So wie ich im Beruf tätig sein möchte, so will ich auch für meine Kinder und meine Partnerschaft tätig sein.-Wie sieht es da mit finanziellen Themen aus? Das ist ja auch ein Argument, das man oft hört, ja, verdient viel mehr, wir können es uns nicht leisten.-Das stimmt auf der einen Seite. Wir haben immer noch den Gender Pay Gap. Nur müssen wir dann genau herausrechnen, was heißt es zum Beispiel, wenn ein Mann auf sechs Monate Karenz geht? Was hat die Familie weniger an Einkommen? Und wir werden merken, das ist nicht so wahnsinnig viel. Es gibt Familien in Österreich, Gruppen von Familien, wo es wirklich nicht geht. Da braucht man gar nicht reden drüber. Und dort geht es einfach nicht, weil er der Einzige ist und eh prekär und, und, und. Aber wenn wir so vom Durchschnitt ausgehen oder so, hat schon Edith Schlaffe in den 1990er gesagt, eine Familie würde ungefähr das Ausmaß eines größeren Familienurlaubs verlieren, wenn er ein halbes Jahr oder sowas auf Karenz geht. Und das ist für viele Familien ja leistbar. Nicht? Aber dann gibt es noch Familien, wo das überhaupt kein Problem ist. Und jetzt müssen wir davon ausgehen, würden die alle gemäß ihrer Überzeugung diese Karenz in Anspruch nehmen, dann entsteht in der Wirtschaft und überall eine große Dynamik, wo jeder Chef weiß, ich werde meinen Vater irgendwann einmal zu Hause haben. Und das wäre sozusagen ein großer, großer gesellschaftspolitischer Schritt, wenn alle die, wo es möglich wäre, in Karenz gehen.-Auch als Vorbildfunktion. Weil es dann normaler wird natürlich.-Ich glaube dieses Argument muss man differenzieren. Ich glaube nicht daran, dass gerade dieser Unterschied wirklich das verhindern könnte, wenn man es wirklich angeht.-Wenn man es wirklich will. Ich habe aber schon den Eindruck, dass sich da viel verändert hat. Also schon noch einmal von meiner Elterngeneration zu mir. Und gerade wenn ich mir jetzt junge Männer anschaue, kommt mir schon vor, dass die mit ihrer menschlichen, oder mit ihrer Rolle, eventuell auch als Vater, schon offener umgehen und da flexibler sind. Ist das so?-Ich würde wieder differenzieren und würde sagen, ja, unter den jungen Männern gibt es auch Gruppen, vielleicht mehr Gruppen, die das positiv annehmen. Ich möchte schon aber noch sagen, es gibt noch sehr, sehr ambivalente Männer, die das nicht so ohne weiteres nehmen. Was wir schon sehen können, ist, dass diese Ideen verstärkt vorhanden sind. Dass sich innerhalb der Männerwelt die Gruppen ausdifferenziert haben. Also wir haben verstärkt Gruppen, die das machen, aber leider Gottes auch Gegenbewegungen. Oder leider Gottes Gruppen, für die das überhaupt kein Thema ist. Da müssen wir schon noch arbeiten dran. Es ist nicht so, dass automatisch durch Jüngere es besser wird. Sondern es ist differenziert zu sehen.-Und die Strukturen sind ja nach wie vor dieselben. haben Sie noch einen Wunsch, wo Sie sagen, das würde ich Vätern gerne mitgeben oder Familien gerne mitgeben, wenn es um das Thema Karenz und Care-Arbeit geht?-Der Wunsch geht davon aus, was ist Care? Und da denkt man immer noch sehr, sehr geschlechtsspezifisch. Nur die Mutter kann. Und der Vater nicht. Und es gibt auch so die ist so von der Distanz, bedingten Väterlichkeit spricht. Wo die sagt, naja Männer sind halt wilder im Spiel und Männer sind halt, die haben mehr die Bindung über das Spiel und so weiter. Und das ist für mich sozusagen etwas, was ich sehr relativieren würde. Care in erster Linie ist eine menschliche Fähigkeit, die darin besteht, dass ich mit dem zu Versorgenden in Beziehung trete, dass ich hier Sorgehaltung, Schutzhaltung einnehme, mich dorthin gebe, mich dort engagiere. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt gerade von Kindern oder von alten, kranken Sterbenden in der Familie ausgehe, ich selbst dann auch den Gewinn habe für mich persönlich. An dem Sinn würde ich sozusagen als Wunsch formulieren und auch für alle als Wunsch formulieren, dass man sich darauf einlässt, dass man diese Pflege- und Sorgendentätigkeiten übernimmt, weil wir persönlich massiv gewinnen.-Dankeschön. Ich glaube, da waren ein paar Anregungen dabei. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio.-Danke. Ich bin gerne gekommen.-Zu Gast bei Christine Oberdorfer war Männlichkeitsforscher Erich Lehner.
Podcasts we love
Check out these other fine podcasts recommended by us, not an algorithm.

Grätzlgeschichten
Stadt Wien
büchereicast
Stadt Wien - Büchereien
Wiener Wohnen Podcast
Wiener Wohnen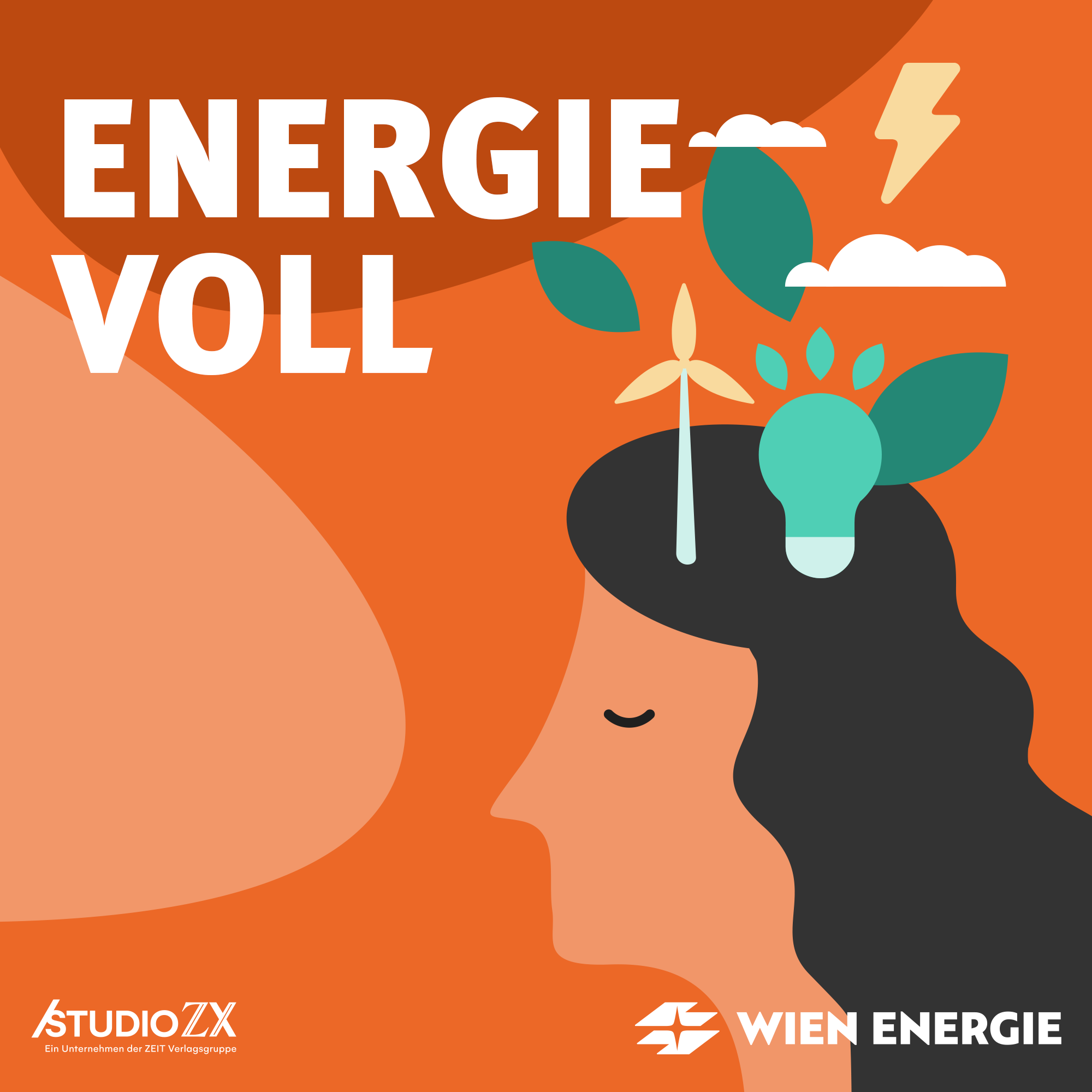
Energievoll
Wien Energie, Studio ZX