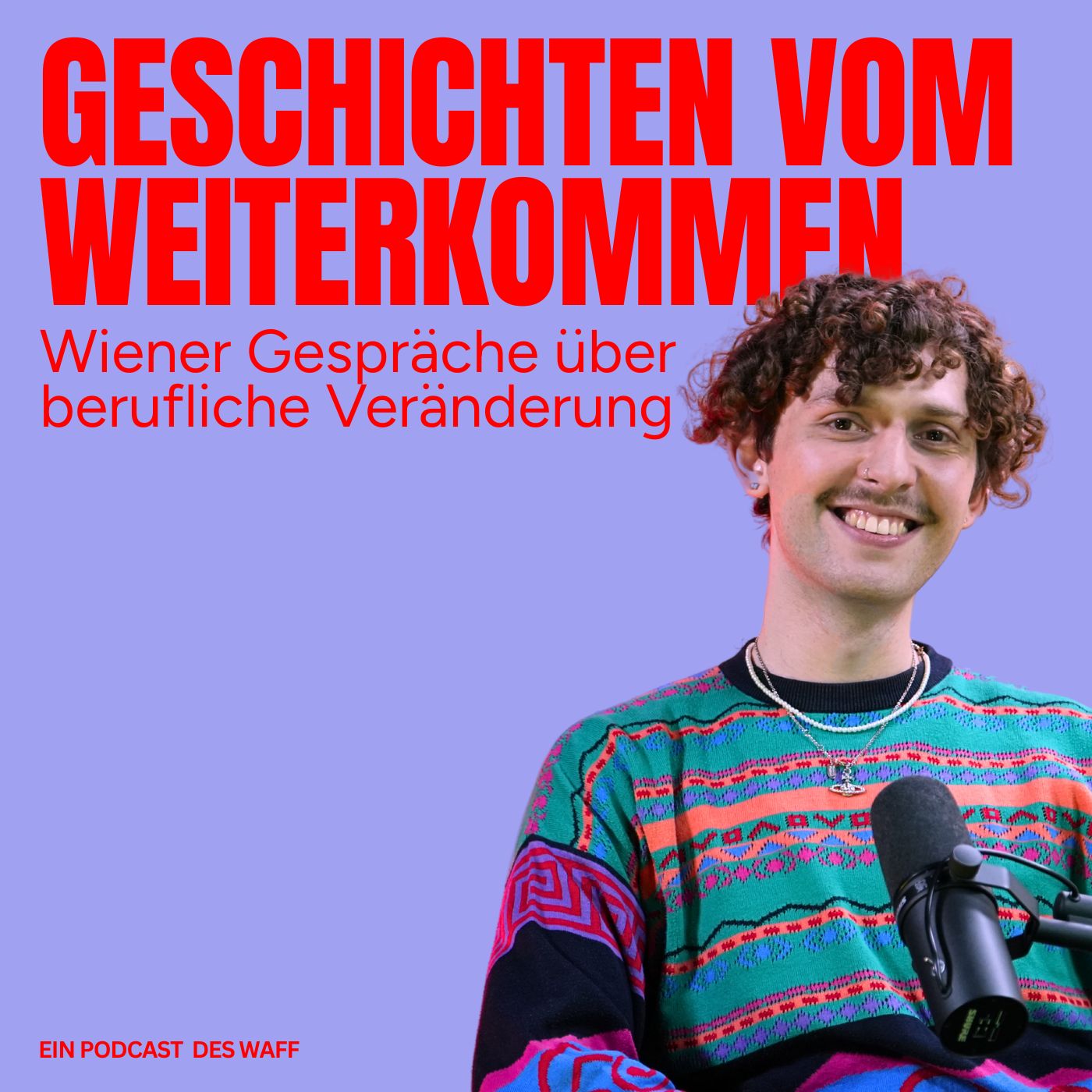Stadt Wien Podcast
Stadt Wien Podcast
Wie Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt wird
Wien will kinder- und jugendfreundlichste Stadt der Welt werden. Wie das gelingen soll, welche Angebote es gibt und wie sich Junge beteiligen können, erzählen Schulpsychologin Clara Steinkogler-Kieslich und Kinder- und Jugendanwalt Sebastian Öhner im Gespräch mit Christine Oberdorfer.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert (falls ihr das noch nicht gemacht habt).
Feedback könnt ihr uns auch an podcast(at)ma53.wien.gv.at schicken.
Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen:
https://www.facebook.com/wien.at
https://bsky.app/profile/wien.gv.at
https://twitter.com/Stadt_Wien
https://www.linkedin.com/company/city-of-vienna/
https://www.instagram.com/stadtwien/
Und abonniert unseren täglichen Newsletter:
http://wien.gv.at/meinwienheute
Weitere Stadt Wien Podcasts:
- Historisches aus den Wiener Bezirken in den Grätzlgeschichten
- büchereicast der Stadt Wien Büchereien
-Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast der Stadt Wien. Christine Oberdorfer spricht mit ihren Gästen über Wiens Jugend.-Wien hat das Ziel, die kinder- und jugendfreundlichste Stadt der Welt zu werden. Was dazu nötig ist, welche Herausforderungen es gibt und wie es den jungen Menschen in Wien jetzt gerade geht, darüber spreche ich mit der Schulpsychologin Clara Steinkogler-Kieslich und dem Kinder- und Jugendanwalt Sebastian Öhner. Danke euch für den Besuch im Studio.-Gerne.-Danke für die Einladung.-Darf ich euch beide kurz bitten, dass ihr euch vorstellt?-Möchtest du beginnen?-Ja, sehr gerne. Mein Name ist Sebastian, Sebastian Öhner. Ich bin Kinder- und Jugendanwalt. Das heißt, ich darf die Kinder- und Jugendanwaltschaft seit Juli 2024 leiten. Ich glaube, was die Kinder- und Jugendanwaltschaft ist, dazu komme ich vielleicht später noch ein bisschen genauer. Und zu mir als Person vielleicht noch. Ich bin von der Grundausbildung her Jurist, habe aber auch eine pädagogische Ausbildung. Und eine Leidenschaft für das Thema Kinderrechte auf jeden Fall.-Ja, dann stelle ich mich auch kurz vor. Mein Name ist Clara Steinkogler-Kieslich. Ich arbeite in Wien als Schulpsychologin. In meinem Fall im Bereich der allgemeinbildenden höheren Schulen. Von meiner Grundausbildung, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin, systemische Familientherapeutin und arbeite jetzt seit gut zehn Jahren als Schulpsychologin in Wien.-Dankeschön. Seid ihr beide in Wien aufgewachsen? Was habt ihr denn so das Gefühl, hat sich da was verändert in den letzten Jahrzehnten für die Kinder und Jugendlichen?-Ja, ich bin in Wien aufgewachsen. Und ich meine, grundsätzlich, glaube ich, hat sich auf der ganzen Welt einiges verändert. Und gerade die Welt von Kindern und Jugendlichen verändert sich, denke ich, sehr schnell. Ein Faktor dafür aus meiner Sicht sind sicher die sozialen Medien, die für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sehr viel verändert haben. Also bei mir ist das schon noch aufgekommen, auf jeden Fall. Also da war Social Media auf jeden Fall schon ein Thema, aber nicht in dem Umfang und dem Ausmaß, wie es jetzt der Fall ist. Also die digitale Welt und der digitale Kontext ist schon etwas, das sich verändert hat, auch für Kinder und Jugendliche in Wien.-Wie ist dein Eindruck?-Also ich bin nicht in Wien aufgewachsen, aber ich bin ab der Oberstufe in Wien in die Schule gegangen. Ich oute mich jetzt als wirklich alt. Bei mir gab es in meiner Schulzeit das Handy in der 8. Klasse bei der Matura. Also davor war das einfach kein Thema. Und damit war es natürlich auch, alles, was man am Blödsinn gebaut hat, wurde von Mund zu Mund weitergegeben. Und es gab keine Snapchat-Videos, die kursiert sind. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo die Kinder und Jugendlichen einfach auch sehr schnell mal überfordert sind, weil einfach alles irrsinnig schnell geht. Alles, was man so macht, ist sofort bei allen präsent. Das bietet natürlich die Plattform für viele Mobbingattacken oder auch sonstige Ausgrenzungen.-Unsere Blödheiten blieben ein bisschen anonymer damals.-Genau und es war kein Zack, bumm und alle wissen es, sondern manchmal hat es ein paar Wochen gedauert und man konnte sich schon gute Ausreden überlegen, warum man da so blöd war.-In Wien leben rund 400.000 Kinder und Jugendliche, habe ich nachgeschaut. Die sind natürlich in sehr unterschiedlichen Lebenswelten. Aber wie würdet ihr denn das einschätzen? Auf einer Skala von 1 sehr gut bis 5 nicht genügend, wie geht es denn den Kindern und Jugendlichen in Wien?-Also statistisch gesehen würde ich sagen befriedigend. Das ist für mich aber keine ausreichende Erklärung, weil es geht um das Spektrum von sehr gut bis nicht genügend. Und es gibt viele, die sind im Bereich nicht genügend unterwegs. Und es gibt sicher auch viele, die sind im Bereich sehr gut unterwegs. Mein Ziel als Schulpsychologin wäre es, dass ich sage, es sind alle im Bereich zwischen sehr gut und gut. Und wenn es einmal auf nicht genügend kommt, dass es dann genug dass man sie wieder dorthin bringt, dass sie sagen, hey, mir geht es sehr gut. Und das wäre das Ziel.-Ich würde sagen, kann mich eigentlich gut anschließen. Was man dazu sagen kann, natürlich ist Wien eine sehr lebenswerte Stadt und das gilt auch für Kinder und Jugendliche. Also auch im Kontext Kinder und Jugendliche würde ich sagen, ist Wien wirklich eine lebenswerte Stadt. Und insofern kann man hier schon auch sehr gut, sehr gut aufwachsen. Natürlich ist Wien auch sehr gewachsen, das heißt auch die Herausforderungen, genug Unterstützung für Kinder und Jugendliche zu bieten, ist mit der Menge an Kindern, mit der Anzahl an Kindern auch natürlich größer geworden. Und das ist ein Thema im Aufwachsen von jungen Menschen.-Was würdest du denn sagen, wenn du sagst, lebenswerte Stadt auch für Kinder und Jugendliche? Was sind denn die Punkte, beginnen wir mit den positiven Punkten, was sind denn die Dinge, die gut funktionieren?-Ja, ich glaube, ähnlich auch wie bei Erwachsenen, also diese ganzen Strukturen von Verkehr, öffentlichem Verkehr, den Freizeit- und Kulturangeboten, die die Stadt Wien bietet, auch schon wirklich die Bildungsangebote, die die Stadt Wien hat. Da gibt es schon viele Punkte, die für Kinder und Jugendliche wirklich ein super Umfeld zum Aufwachsen bieten. Also man kann sicher sehr viel Positives finden, wo wir als Kinder- und Jugendanwaltschaft hinschauen und dafür sind wir auch natürlich eingerichtet, als Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche ist auch die Kinder und Jugendlichen gut zu unterstützen, die eben besonders, besondere Unterstützung kriegen. Und da gibt es auch ein paar Punkte, die auf jeden Fall noch, wie soll man sagen, anzugehen sind.-Welche wären denn das?-Ich meine, man muss immer sagen.-Wir kommen dann eh noch ein bisschen drauf, wir müssen dann eh noch auf die einzelnen Punkte ein bisschen genauer eingehen. Aber was wären denn so die Punkte, wo du sagst, da wäre definitiv noch Luft nach oben?-So pauschal zu sagen, ist das eine, das ist nicht einfach, weil man denken muss, Kinderrechte und quasi Themen von Kindern und Jugendlichen ist natürlich eine Querschnittsmaterie. Es geht um das gesamte, den gesamten Lebensbereich von Kindern und Jugendlichen. Und ich sehe es auch schon so und so sind auch Kinderrechte ausgestattet und so ist, muss man glaube ich auch herangehen, wenn es um die lebenswerteste Stadt für Kinder und Jugendliche oder kinderfreundlichste Stadt geht, dass man sich immer in eigentlich allen Bereichen weiterentwickeln muss. Und das ist ein Punkt, den wir auch als Kinder- und Jugendanwaltschaft sehen, wo wir sehen, wo Kinder- Jugendliche jetzt zu uns kommen, wo viel quasi Bedarf ist auf jeden Fall, ist einerseits an der psychosozialen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Also psychische Gesundheit ist ein großes Thema für Kinder und Jugendliche auch in Wien, wo es eben darum geht, die Unterstützungssysteme auszubauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich so Unterstützung bieten zu können, dass sie bei den Kindern und Jugendlichen auch tatsächlich ankommt und auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen werden kann. Also das ist ein großer Aspekt, mit dem wir uns auseinandersetzen. Ein zweiter, schon angeschnitten im Intro vielleicht, die digitalen Rechte von Kindern und Jugendlichen. Das ist ein Thema, das Kinder und Jugendliche oft überfordert, aber auch quasi aus einer Verwaltungsperspektive vielleicht überfordern kann, weil die Punkte, wo man hier wirklich ansetzen kann, gar nicht so einfach zu finden sind teilweise. Und hier aber wirklich mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, zu schauen, was brauchen sie eigentlich, was sind quasi Ansatzpunkte, wie man das Leben von Kindern und Jugendlichen auch aus einer digitalen Perspektive besser unterstützen kann. Also das Aufwachsen, das ist etwas, mit dem wir uns auch viel auseinandersetzen. Und ganz generell etwas, das einfach, wie soll man sagen, noch immer im Prozess ist. Ich glaube, ich würde sagen, dass Wien schon nicht schlecht, aber das ist ein weiterer Prozess. Alle Dinge, die Kinder und Jugendliche betreffen aus Perspektive von Kindern und Jugendlichen zu denken, weil oft sind Strukturen so aufgebaut, dass man quasi Kinder und Jugendliche natürlich berücksichtigt hat, aber vielleicht nicht aus ihrer Perspektive geplant hat. Und da versuchen wir es, Kinder- und Jugendanwaltschaft schon anzusetzen, zu sagen, noch stärker aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen zu planen, weil es dann besser in ihrer Lebenswelt ankommt und vor allem auch Wege und Mechanismen zu finden. Kinder und Jugendliche auch in die Planung noch stärker mit einbeziehen zu können, und zwar bei allen Themen, die sie betreffen.-Ich glaube, dein Stichwort war hier die psychische Unterstützung, gell?-Ja, ist natürlich ein großes Thema. Also wir haben jetzt durch dieses gesund aus der Krise Projekt wirklich viel dazu gewonnen. Es war unglaublich toll, weil wir auch als Schulpsychologen einfach weitervermitteln konnten. Wir haben gewusst, die Kinder kommen gut an, sind versorgt.-Erzählst du etwas zu dem Projekt?-Ja, das ist ein Projekt vom Berufsverband in Österreich. Das ist Psychologen, wo Kinder und Jugendliche 10 bis 15 Psychotherapieeinheiten bekommen oder Einheiten psychologischer Behandlung. Das Ganze kostenfrei mit relativ unbürokratischen Anmeldemöglichkeiten. Und das war einfach wirklich ein Gewinn für uns. Angeblich wird das Projekt auch verlängert. Das habe ich zumindest schon mehrfach gehört. Ich hoffe, dass es tatsächlich so ist, weil wir natürlich in der Schule, wir haben im Durchschnitt einen Sprechtag von sechs Stunden an einer Schule alle 14 Tage für alle Schüler und Schülerinnen dieser Schule. Das ist natürlich sehr wenig. Das heißt, wenn wir bemerken, da braucht es mehr, hat es früher geheißen, naja, melden wir halt mal an für einen kassenfinanzierten Platz. Das dauert dann so circa ein halbes Jahr. Was mache ich mit dem Kind, das verzweifelt vor mir sitzt und sagt, hey, cool, in einem halben Jahr hast du dann Unterstützung. Das können wir nicht machen. Und dafür war das Projekt einfach wirklich sensationell, weil es relativ rasch gegangen ist. Also es waren wirklich so teilweise ein bis zwei Monate und die Kinder waren dort angebunden und wir haben gewusst, passt, die sind in guten Händen.-Ja, wenn wir von psychischen Problemen sprechen, ist es so, dass die tatsächlich zunehmen, ADHS, Suchtthematiken, die verschiedensten Themen. Nehmen die wirklich zu oder schauen wir einfach nur genauer hin?-Ich glaube, es ist eine Kombination. Ich glaube, die Kombination ist, man schaut genauer hin, dann entdeckt man mehr und man hat sich mehr damit befasst. Das heißt, man hat für viele Dinge einfach schon eine Diagnose oder einen Begriff. Also wenn Kinder zu mir kommen, kommen sie oft mit, ich habe Panikattacken oder ich habe ADHS. Und dann sage ich, wow, wir hatten das Diagnostikum. Ja, ich habe gegoogelt. Also Mr. Google bietet oft wirklich gute Diagnosen. Manchmal schließe ich mich denen dann auch an, nach meinem Anamnese-Gespräch, aber manchmal auch nicht. Und ich glaube, es ist einerseits immer noch so ein bisschen peinlich, dass man was hat und dass man da zum Psychologen geht, aber andererseits ist es dann auch oft so ein bisschen eine Entschuldigung für, ich kann nicht das leisten, was die anderen leisten oder ich bin ein bisschen anders als die anderen. Also Kinder versuchen sich dann natürlich auch aus einem, sage ich, Adressen zu Also ich mal das Defizit oder aus einer Andersartigkeit irgendwie einen Gewinn zu holen, was natürlich klar ist. Aber da werden halt oft Diagnosen um sich geworfen, die ich so nicht immer bestätigen kann.-Was für Themen haben denn, oder was für psychische Themen haben denn die Kinder und Jugendlichen?-Das ist sehr mannigfaltig. Also wenn ich jetzt an meine letzte, an meine Arbeitswoche denke, dann ist massiver Liebeskummer, das sind Panikattacken, das ist Schulangst. Das ist auch tatsächlich einer der häufigsten Gründe, warum Kinder und Jugendliche sich suizidieren. Also es klingt jetzt immer so lustig, aber das ist tatsächlich ein wirklich gravierendes Thema oft, was man nicht so unter den Tisch wischen sollte. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, Ängste. Legasthenie. Einfach Verhaltensauffälligkeiten jeglicher Art. Ja, also im Prinzip von bis. Und das Schöne ist, wir wissen ja nie, was kommt. Oft kommen Kinder zu mir und sagen, zu Hause ist es ein bisschen schwierig. Und im Endeffekt kommt man darauf, dass es eine Thematik über Sexualität oder diese Themen sind, die halt nicht so offiziell auf einer Anmeldeliste draufstehen.-Und kommen die Kinder dann aus eigenem Antrieb zu dir oder werden die geschickt von den Lehrerinnen und Lehrern oder von den Eltern? Oder wie funktioniert das?-Also im besten Fall kommen sie von selbst, weil sie selber das Gefühl haben, sie wollen etwas verändern oder sie brauchen Unterstützung. Das ist nicht immer der Fall natürlich. Also wir haben Zuweiser, Eltern, Lehrer, manchmal Direktoren. Das heißt, die sagen, okay, da sollte mal jemand draufschauen, dann werden sie zu uns geschickt. Es ist natürlich immer freiwillig, weil ein Kind, das nicht mit mir reden möchte, muss nicht mit mir sprechen. Aber ja, also so funktioniert eigentlich ganz gut, dass alle rundherum zuweisen. Und je mehr Leute hinschauen, desto mehr. Fälle haben wir auch. Da sind wir wieder bei dem Thema, gibt es jetzt mehr? Ich glaube, es gibt einfach den Unterschied, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man oft was. Und es ist gut, wenn hingeschaut wird, weil oft kommen dann nach Jahren Dinge, wo schon ganz viele weggeschaut haben. Und die Kinder sich dann auch nicht mehr ernst genommen fühlen.-Ich würde vielleicht noch zwei Komponenten dazugeben, die schon wichtig sind zu erwähnen, denke ich mir. Das eine ist Zukunftsängste von Kindern und Jugendlichen. Also auch durch die digitale Komponente. Nicht nur, aber auch bekommen sie einfach schon sehr früh sehr viel vom Weltgeschehen mit. Und wenn jetzt quasi eine vielleicht nicht so rosige Stimmung ist, wie jetzt quasi Zukunftsplanung weltweit, Stadt Wien weit, österreichweit, aber auch weltweit stattfindet, dann bekommen das Kinder und Jugendliche auch mit und bekommen auch dadurch einen Druck. Und das sehen wir dann an verschiedenen Themen, die auch für Kinder und Jugendliche am wichtigsten sind. Das war lange Zeit zum Beispiel Klimawandel, Klimaschutz, das war auch Krieg in anderen Ländern beispielsweise. Und das sind doch Ängste, die bei Kindern und Jugendlichen dann auch aus unserer Sicht spürbar werden. Das muss man doch mit berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche sehr früh, nämlich explizite Inhalte, ich glaube schon früher hat man ja auch mitbekommen, vielleicht ist die Stimmung nicht so gut, aber jetzt durch gerade auch Social Media bekommt man aufs Handy lauter Videos zugespielt, wie Waldbrände sind oder Kriegsschauplätze und das schon von einem sehr frühen Alter weg. Und natürlich wirkt sich das auch auf die psychische Gesundheit oder kann es sich, sage ich jetzt mal, wenn ich zu viel da eingreife, auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auswirken. Und das Zweite, womit wir uns schon noch auseinandersetzen, sind doch auch noch die Nachwirkungen von der Coronazeit, wo Kinder und Jugendliche oft in sehr essentiellen Zeitpunkten in ihrem Aufwachsen sehr eingeschränkt waren, in sozialen Kontakten beispielsweise. Und das macht natürlich auch etwas aus, also sehen wir das dann immer wieder auch in Gruppenkonstellationen, in Schulklassen beispielsweise, dass es für Kinder und Jugendliche zum Teil schwierig ist, auch in Gruppen sich gut zurechtzufinden beispielsweise. Und da gibt es einige interessante, interessante Beobachtungen, woher das kommt und ob man das eben auch, worauf man das zurückführen kann. Aber das sind sicher Aspekte, die Kinder und Jugendlichen Stress machen können, sage ich mal, die wir auch in unserer Beratungsarbeit dann immer wieder merken.-Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also es war jetzt eine lange Zeit die ersten Klassen-AHS immer wieder spannend. Weil das Kinder sind, die einfach in dem ersten Lernprozess von sozialer Interaktion, in einer Klasse und auch dem Einordnen in ein System, das hatten die nicht oder kaum, weil halt da Homeschooling war oder weil sie überhaupt zu Hause waren. Und dieser erste soziale Einordnungsprozess in ihrem Leben hat nicht stattgefunden. Also im Kindergarten schon, aber das ist jetzt noch nicht so tragend. Und das war schon sehr spannend, dass da die ersten Klassen in den AHS oft sehr gestruggelt haben, die wieder sozusagen in eine Einheit zu formieren, weil die das gar nicht gewohnt waren. Ja. Und was du sagst bezüglich Zukunftsängste, das sehe ich auch sehr stark. Also das ist ein Thema, mit dem kommen öfter die Oberstufenschüler. Weil halt einfach das, was man so mitkriegt, ich muss so viele Entscheidungen treffen, es gibt so viele Wahlmöglichkeiten und wenn ich eine Entscheidung treffe, ist es dann die richtige Entscheidung. Und ich glaube mit dieser Mannigfaltigkeit an Berufen und an Ausbildungswegen, die wir jetzt haben, es ist toll, dass wir so viel haben, wir haben viele Wahlmöglichkeiten, aber mit jeder Wahlmöglichkeit wächst natürlich auch der Stress auf das Individuum, ich muss mich entscheiden. Und Entscheidungen sind oft sehr belastend. Wenn man nicht genau weiß, was man will, ist eine Entscheidung anstrengend. Und das kostet jungen Menschen sehr viel Energie. Und natürlich in Zeiten der Inflation gibt es genug Kinder und Jugendliche, die einfach sehen, wow, also mit meinen Eltern, das geht sich gerade noch aus, dass die unser Leben finanzieren. Was kann ich machen, damit das bei mir anders ist? Stresst natürlich auch.-Oder wie kann ich meine Familie unterstützen zum Teil auch? Genau. Also auch da das Verantwortungsgefühl von jungen Menschen dann auch schon recht früh.-Große Last auf den Kindern.-Ich kann nicht studieren, weil ich muss arbeiten gehen, damit meine kleine Schwester dann noch irgendwie mehr Möglichkeiten hat.-Damit sich das Finanzieren besser ausgeht.-Genau. -Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Sorgen und Probleme die Kinder haben. Ich kann mir das schon vorstellen: Krieg, Inflation, das sind schon große Themen. Schlagen die bei euch in der Beratung mit solchen Themen auf? Wie könnt ihr denen helfen?-Wenn Kinder und Jugendliche zu uns kommen, ist es meistens wegen sehr expliziten Themenstellungen. Das ist jetzt nicht so, dass quasi ich sagen würde, dass die Zukunftsängste, dass sie in unsere Beratung kommen wegen Zukunftsängsten, beispielsweise Krieg oder Klimawandel, wie wir vorher gesagt haben. Sondern sie kommen dann eben, wie soll man sagen, entweder mit Problemen zu Hause in der Familie, also Druck in der Familie. Oder sie kommen auch zum Beispiel zum Thema Mobbing, wenn sie in den Klassen sich nicht gut, also ja, wenn sie auch mit Mobbing zu tun haben in den Schulklassen. Das sind so Themen, mit denen sie zu uns kommen. Ich würde sagen, generell schlägt sich, also wo man sieht, dass diese Themen eine Rolle spielen, sind auch immer wieder bei den Umfragen. Was beschäftigt Kinder und Jugendliche am meisten? In der Beratung sind das jetzt nicht Themen, die wir so explizit durchbesprechen. Das ist aber auch immer wieder interessant. Weil, dass das Kinder und Jugendliche viel beschäftigt, zeigen uns viele Studien. Was immer bei Kindern und Jugendlichen dazu kommt, ist ein bisschen so ein Teil von einer Ohnmacht. Weil, wenn wir jetzt an Erwachsene denken, kann ich ja zu den Themen, die mich sehr viel beschäftigen, durch meine Arbeitsleistung, durch eine Beteiligung an der Zivilgesellschaft, durch meine Wahlentscheidungen oder dergleichen, kann ich ja eigentlich schon sehr Und ich glaube schon, dass Kinder und Jugendliche eben sehr früh jetzt schon merken, da ist was quasi Schwieriges, das auf uns zukommt. Und dann doch ein bisschen in dieser Handlungsunfähigkeit vielleicht zum Teil sogar halt gefangen sind. Ich finde es dann immer wieder bemerkenswert, dass es quasi viele Kinder und Jugendliche gibt, die sich auch für ihre Rechte dann auch entsprechend einsetzen. Sei es jetzt, wenn sie jetzt irgendwie sich auf Themen aufmerksam machen. Sei es jetzt, wenn sie sich zu Zum Zum Beispiel in Wien beim Kinder- und Jugendparlament beteiligen und da auch mitwirken. Wir haben einen eigenen Jugendbeirat, wo Kinder und Jugendliche unsere Arbeit mitgestalten können. Also das sind Mechanismen, die jetzt aufgebaut wurden und noch weiter aufgebaut werden, wo man auch solche übergeordneten Themen quasi vielleicht, die jetzt nicht unbedingt im Alltag sind, anbringen kann. Und das ist neben der Fallberatung, wo wir quasi wirklich an expliziten Themen arbeiten, die sich noch stärker in der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen abspielen, Möglichkeiten schaffen und aus meiner Sicht noch weiter schaffen müssen, Kinder und Jugendliche wirklich zu beteiligen an den Strukturen, damit sie auch mitentscheiden können.-Das ist ja auch ein ganz klares Kinderrecht, dieses Recht auf Beteiligung.-Das Interessante ist ja eigentlich, dass das sogar in der Verfassung verankert ist. Also an höchster Stelle kann man sagen. Das gibt es für uns Erwachsene in dem Fall gar nicht so stark. Wie für Kinder und Jugendliche Artikel 4 des Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte von Kindern und Jugendlichen, das eigentlich besagt, dass Kinder und Jugendliche bei allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrer Entwicklung und Reife mitsprechen und mit auch entscheiden können müssen. Manchmal wird das dann so verwechselt, sie müssen jetzt nicht immer die Entscheidung treffen, aber mitentscheiden und die Stimme quasi auch mit in die Waagschale werfen. Das ist schon ihr Recht auf jeden Fall und quasi auch eine Verpflichtung von den Strukturen, ihnen diese Mitentscheidungsmöglichkeit auch zu geben. Und für alle Kinder und Jugendlichen nämlich auch diese Mitentscheidungsmöglichkeiten zu schaffen. Auch zum Beispiel unabhängig von einem Wahlrecht beispielsweise Möglichkeiten zu schaffen, wo Kinder und Jugendliche ihre Lebenswelt, ihre Lebensrealität auch gut mitgestalten können. Das gibt schon Handlungssicherheit. Das gibt schon auch quasi irgendwie das Gefühl, ich kann mitgestalten. Das Gefühl auch. Ich kann eben, weil wir auch gesprochen haben, in kleinen Gruppen, aber auch so quasi in der Gemeinschaft mich einfinden. Auch das ist natürlich dann ein super Faktor, wenn ich sage, ich kann wirklich was mitentscheiden und sehe dann, dass sich was verändert, weil ich mich einsetze mit anderen Menschen, weil ich in Kontakt trete mit anderen Menschen. Das wirkt sich dann schon noch auf dieses Gemeinschaftsgefühl aus und ist eigentlich ein Kinderrecht.-Erzählst du uns was grundsätzlich über Kinderrechte? Was sind denn da so die wichtigsten Kinderrechte, die einfach jeder wissen sollte?-Also Kinderrechte ist ein vielleicht Fun Fact ist, die Kinderrechte sind aus der Kinderrechtskonvention entstanden. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag und das ist der, also das ist jetzt der Fun Fact, ist der häufigst ratifizierte völkerrechtliche Vertrag, den es hier gegeben hat. Das heißt, fast alle Länder haben sich den Kinderrechten quasi verschrieben und gesagt, wir setzen sie in den jeweiligen Nationalstaaten um. So das ist mal die Grundlage. Ein wirklich wichtiger Perspektivenwechsel, an dem wir quasi auch noch immer weiter dran sind und dran sein müssen, ist eben, dass jetzt dann Kinder und Jugendliche eigenständige Rechtsobjekte sind, die auch quasi aus deren Perspektive auch gedacht und geplant werden muss. Das war zum Teil vorher schon so, aber nicht so umfänglich, wie wir es seit der Kinderrechtskonvention als Grundlage und Grundvoraussetzung haben. Das Wichtige in Österreich ist nicht nur die Konvention, sondern, und das ist weltweit sehr besonders in Wahrheit, dass wir eigene Verfassungsrechte haben für Kinder und Jugendliche. Das heißt, wir haben verfassungsrechtliche Bestimmungen, die die Kinderrechte in Österreich wirklich umsetzen sollen. Da kann ich sagen, ist es schon so, dass noch ein bisschen was an Nachholbedarf ist. Also es gab jetzt erst vor kurzem eine Studie, die sich angeschaut hat, wie sehr wurde dieses Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern und Jugendlichen schon berücksichtigt. Und die Studie hat doch, doch sehr viele Lücken aufgezeigt, kann man sagen, wo jetzt gerade auf diese kinderrechtlichen Bestimmungen noch nicht immer auch in ausreichendem Umfang Rücksicht genommen wurde. Was sind die wichtigsten Rechte? Was sich alle merken können sollen, ist Kindeswohl und Kindeswohl-Vorrangigkeitsprinzip. Kindeswohl bedeutet, dass jede Entscheidung, die Kinder und Jugendliche betrifft, im bestmöglichen Interesse für Kinder und Jugendliche getroffen werden soll. Das heißt, eine Entscheidung kann alles sein. Das ist in der Familie in die Richtung, mit dem Kind zu entscheiden, welche Schule ist vielleicht die beste oder die spannendste. Das ist quasi im Grätzl vielleicht mit zu entscheiden, wo gibt es Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Und das ist auf einer höheren Ebene mit zu entscheiden, wie kann ich Kinderarmut verhindern und wie kann ich Chancengleichheit herstellen. Das Kindeswohl spielt sich wirklich auf allen Ebenen in Wahrheit ab und ist so die zentrale Bestimmung. Eine, die ich auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte, ist auch das Gewaltverbot. Also wir haben in der Verfassung ein Gewaltverbot verankert, dass Kinder und Jugendliche das Recht auf Schutz vor jeder Form von Gewalt haben und das umfänglich in allen Bereichen. Und das ist auch, würde ich sagen, ein sehr zentrales Recht neben den anderen, die wir dort verankert haben.-Ist Gewalt, aus deiner Erfahrung, wie gut sind Kinder vor Gewalt geschützt? Ich glaube, solche Kinder kommen wahrscheinlich auch oft zu dir. Ja.-Kommen auch zu mir. Natürlich ist es auch ein Thema. Es ist immer noch ein Thema, was sehr schambehaftet ist. Das heißt, die Kinder kommen dann meistens nicht mit dem Thema ich werde zu Hause geschlagen, sondern mit irgendwelchen anderen Themen. Und wenn man dann dran bleibt, merkt man irgendwann, okay, das Grundthema ist ein anderes.-Und da geht es um körperliche Gewalt oder wahrscheinlich auch um psychische Gewalt?-Beides. Leider immer noch beides.-Wie kannst du den Kindern helfen? Sprichst du dann mit den Eltern? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kannst du so einem Kind helfen?-Na ja, wenn eine akute Gefährdung vorliegt, muss ich natürlich eine Gefährdungsmeldung machen bei Kinder- und Jugendhilfe. Ich kann dann den Kindern eigentlich nur beistehen in dem Prozess, was passiert weiter. Ich kann schauen, dass sie einen sicheren Ort haben, wo sie sich hinwenden können. Ich kann sie mit Notfallnummern ausstatten. Ich kann ihnen einen Tipp geben, dass sie sich einen stillen Alarm am Handy machen können, wo sie Hilfe holen können, ohne dass gesprochen wird. Das ist vielleicht eine ganz gute Info für alle Kinder, dass man sowas auch haben kann. Ja, und dann versuche ich dran zu bleiben und schaue, was passiert mit den Kindern. Kommen die in gute Hände oder wird einfach mit den Eltern so viel gearbeitet, dass es ihnen danach besser geht? Oft sehr schwierig.-Glaube ich. Gut, den Eltern geht es ja auch nicht gut dabei. Die machen das ja jetzt auch nicht, weil sie von Grund auf bösartig sind.-Nein, ich glaube, es gibt oft eine ganz große Überforderung dahinter oder einfach ein Lernen am Modell, das sie selber erlebt haben. Viele Kinder werden geschlagen, weil der Vater wurde geschlagen und der Großvater wurde geschlagen und der Urgroßvater wurde geschlagen und das ist einfach eine Tradition und es gibt keine Handlungsalternativen, weil sie einfach so aufgewachsen sind und keine anderen Handlungsalternativen kennen. Dann geht es in erster Linie darum zu schauen, dass man ihnen einfach ein paar Tools in die Hand gibt. Wie kann ich mein Kind anders erziehen als mit Schlägen?-Das heißt, das gesunde Watschen ist noch lange nicht vorbei?-Leider nicht, nein.-Und es gibt auch Statistiken, dass in dem Bewusstsein, dass das eigentlich verboten ist, also Gewalt als Erziehungsmittel, auch noch nicht so angekommen ist. Also schon länger nicht mehr, aber ich glaube, die letzte Studie war rund um 2019, glaube ich, wo eigentlich noch ein sehr hoher Prozentsatz gar nicht das quasi als Problem in dem Sinn anerkannt hat, eben sowas wie eine Gewalt als Erziehungsmittel anzuwenden.-Gibt es da Zahlen dazu, wie viele Kinder mit Gewalt konfrontiert sind in der Familie?-Ich meine, einerseits, ich sage quasi eine allgemeine Statistik, wäre wahrscheinlich gar nicht so einfach herauszuziehen. Was wir natürlich haben, sind Statistiken, in wie vielen Fällen die Kinder- und Jugendhilfe beispielsweise involviert ist. Also die sind immer wieder bei Fällen von Gewalt, aber natürlich auch nicht nur. Ihr habt sicher Fallzahlen, die ihr jedes Jahr erhebt. Wir haben Fallzahlen, die wir jedes Jahr erheben. Aber so quasi, dass es jetzt eine allumfängliche Zahl gäbe, wo man sagt, so und so viele Kinder sind von Gewalt in Familien betroffen, wäre mir zumindest nicht bekannt.-Und das wäre ja dann auch nur eine offizielle Zahl ohne Dunkelziffern.-Genau. Das muss man auf jeden Fall noch mit berücksichtigen. Und das ist schon auch was, warum wir so quasi immer als Kinder- und Jugendanwaltschaft auch sagen, die Unterstützungssysteme zu stärken dort, wo Kinder und Jugendliche sind. Weil wir müssen Systeme schaffen, wo Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, selbstständig vielleicht auch hinzugehen. Oder das System ist so nah und greifbar und erreichbar sind, dass eben diese Dinge auch auffallen. Weil viel eben wird sich dann trotzdem noch in einer Art Dunkelziffer abspielen. Und ja, da muss man weiter daran arbeiten, dass das eben verbessert wird.-Ihr als Kinder- und Jugendanwaltschaft, würdest du eure Aufgaben also grundsätzlich umreißen? Warum gibt es euch?-Wir sind eine unabhängige und weisungsfreie Ombudsstelle. Es gibt in jedem Bundesland eine Kinder- und Jugendanwaltschaft. Wir haben eigentlich vier, würde ich sagen, recht klare gesetzliche Aufgaben. Das eine ist Beratung und Unterstützung. Das heißt, wir bieten Beratung und Unterstützung in eigentlich allen möglichen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen an. Was sind so unsere Hauptschwerpunkte, würde ich mal sagen? Das eine ist im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Also wenn Kinder und Jugendliche mit der Kinder- und Jugendhilfe in Kontakt sind, bieten wir Beratung an. Explizit beispielsweise für Kinder und Jugendliche, die in WGs oder Krisenzentren sind. Da machen wir auch Monitorings. Das heißt, wir gehen auch wirklich in WGs und Krisenzentren hinein, reden mit den Kindern und Jugendlichen, wenn sie eine externe Vertrauensperson auch brauchen, die sich für ihre Rechte vielleicht auch einsetzt. Der zweite große Bereich ist der Bereich der Bildung. Also da haben wir einerseits in Schulen, aber auch in der Elementarpädagogik Expertinnen und Experten. Die bei uns eben Fallarbeit machen. Das sind dann Fälle von Mobbing beispielsweise, Diskriminierungsfälle, Inklusion. Das ist ein großes Thema bei uns. Also Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ist ein großes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen in unserer Fallberatung auch. Und so gibt es im Bildungskontext eben verschiedene Themen, mit denen wir zu tun haben. Und dann gibt es noch einen sehr breiten Bereich von allen anderen möglichen Themen, die Kinder und Jugendliche beschäftigen. Das kann sein von der Prävention von Kinderarmut beispielsweise, sind aber auch so Themen wie Zwangsheirat beispielsweise, die bei uns landen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Also da ist wirklich ein sehr großes Spektrum gegeben. Wir beraten, unterstützen Kinder, Jugendliche, Familien und versuchen dann auch Professionist*innen, also Fachpersonen zu unterstützen oder auch Fachpersonen weiterzuleiten. Das ist unsere Rolle in der Fallarbeit und im Monitoring. Das zweite ist die Interessensvertretung. Das heißt, wir versuchen auf systemischer Ebene zu erkennen, welche Fälle kommen immer wieder vor und wie können wir quasi Systeme bauen, damit die Rechte von Kindern und Jugendlichen besser geschützt oder eingehalten werden. Ein gutes Beispiel finde ich sind die Kinderschutz in Schulen und in Bildung, also in den elementarpädagogischen Einrichtungen. Da tut sich auf jeden Fall etwas. Und ein anderes Beispiel, wo wir sehen, wo wir systemisch arbeiten, ist auch bei dem Thema Mobbing, wo wir jetzt eine neue Mobbing, einen Ratgeber zum Umgang mit Mobbing quasi herausgegeben haben. Wir sehen einfach, da gibt es quasi, da können wir unterstützen mit Wissensbildung. Dritter Punkt, Wissensbildung, also über Kinderrechte reden, erzählen. Also auch das, was ich jetzt mache, ist unsere gesetzliche Aufgabe. Und das vierte ist eine Art Vernetzungsaufgabe. Das heißt, wir versuchen zu vernetzen zwischen Kindern und Jugendlichen, einzelnen engagierten Personen der Zivilgesellschaft, das heißt zivilgesellschaftlichen Organisationen, der Verwaltung und auch der Politik. Also wir versuchen so quasi überall vernetzt zu sein, die Themen einzuholen, die Kinder und Jugendliche betreffen und dann zu überlegen, wie man quasi den Austausch zwischen diesen verschiedenen Bereichen schaffen kann. Mhm.-Deine Aufgabe als Schulpsychologin, wie würdest du die umreißen? Beziehungsweise erzähl uns mal, was machen Schulpsychologen? Wo sind die? Wo gibt es die überall? Wie viele gibt es von euch?-Oh, das waren viele Fragen auf einmal. Also in Wien ist es so, dass es aufgeteilt ist nach Schulart. Das heißt, wir haben in den Pflichtschulen Schulpsychologen, wir haben Schulpsychologen in den allgemeinbildenden höheren Schulen, wir haben Schulpsychologen in den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen und in den Berufsschulen. Wir sind, glaube ich, über alle Bereiche ca. 60 Personen und es ist jeder Bereich ein bisschen anders strukturiert. Also ich kann jetzt sagen, wir in den AHSen, das heißt im Gymnasium, da läuft es so ab, dass eine Schulpsychologin meistens einmal alle 14 Tage einen Sprechtag an der Schule hat. Bei mir ist es so, ich kriege in der Früh dann meine Sprechstundenliste und da stehen dann die Namen drauf. Manchmal steht sogar dabei, wer zuweist oder was das Thema sein soll. Und dann fangen wir an zu arbeiten.-Wie lange hat das Kind dann oder der Jugendliche, der die jugendliche Zeit?-Also normalerweise eine Schulstunde. Wobei, wenn es Fälle sind, wo es länger dauert, dann muss man halt ein bisschen schauen, dass man es irgendwie unterkriegt.-Die Schule ist sicher ein sehr prägender Bereich für jedes Kind, für alle Jugendlichen. Was können denn die Eltern tun, um ihre Kinder in einer gesunden, normalen, wie auch immer psychischen Entwicklung zu unterstützen? Was sind denn da so die wichtigsten Kernpunkte, wo du sagst, das würde ich mir von den Eltern an Unterstützung erwarten?-Ich glaube, es ist zuhören, nachfragen und in Kontakt bleiben. Und Erziehung im Sinn von, ich bringe dir etwas bei und ich schaue, dass du dein Leben in die richtige Bahn kriegst, das funktioniert bis ca. 10 oder 12 und danach ist es eigentlich nur mehr Beziehung. Und wenn bei der Erziehung nichts weitergegangen ist, dann wird es mit der Beziehung auch wirklich schwierig. Weil man kann schwer mit jemandem in Beziehung treten, wo es einfach zu wenig Basis gibt. Und das passiert leider bei manchen Familien auch. Dass einfach zu wenig Zeit ist, zu wenig Raum für Gespräche, zu wenig Möglichkeiten. Oder dass der Alltagsstress der Eltern einfach so groß ist, dass die Kinder irgendwie untergehen.-Das heißt, sich mehr Zeit nehmen oder was wären denn so konkrete Tipps? Das klingt jetzt zu blöd. Aber ein paar so konkrete Ideen? für Eltern, wie sie es im Alltag besser machen können? Zeit nehmen?-Ich glaube, Zeit nehmen, wertschätzen, das Gefühl geben, dass das Kind was Tolles ist, auch wenn es gerade stressig ist und wenn es vielleicht jetzt gerade mal den Fetzen nach Hause gebracht hat. Du bist trotzdem ein Kind, du bist toll. Deine Leistung gerade ist nicht so toll, aber daran können wir arbeiten. Ja, das Kind nicht immer, also wir sind in einer Leistungsgesellschaft und unsere Kinder wachsen auf mit schneller, höher, weiter, besser. Und wenn schneller, höher, weiter, besser nicht ist, dann bist du nicht gut. Und das ist etwas, was ganz furchtbar ist für Kinder. Und ich habe wirklich viele Kinder bei mir sitzen, die einfach Leistungsängste haben, Prüfungsangst, Versagensängste, Zukunftsängste, weil die einfach nie gesagt kriegen, du bist gut, du bist toll, du schaffst das, du kannst das, du machst das. Und unsere Gesellschaft ist immer noch aufgebaut, es wird nach Fehlern gesucht und Fehler werden gezählt. Es wird nie gesagt, hey, wow, das hast du gut gemacht. Und ich zitiere da gerne den Eckart von Hirschhausen, der sagt, man muss die Stärken stärken und nicht versuchen, an den Schwächen weiter herumzubasteln. Ein Kind, das legasthen ist, das braucht so viel Kraft für die Schule. Na, was passiert? Es möchte Geige lernen, zum Beispiel. Die Eltern sagen, na ja, wenn deine Schulnoten gut sind, dann darfst du Geige lernen. Das heißt, etwas, wo das Kind Interesse hätte und vielleicht auch Begabung und Fähigkeiten, das wird nicht ermöglicht, weil die Schwäche da ist mit der Legasthenie. Und da muss man so viel arbeiten und so viel lernen zu Hause. Und das ist halt das, wo es wirklich schwierig wird, weil gerade Kinder, die einfach wirklich Fähigkeiten hätten, in was auch immer für einem Bereich gar nicht dazu kommen, weil diese Keule mit die Bildung zuerst und das muss funktionieren, das ist halt schwierig. Das ist sehr schwierig.-Ja, als erwachsener Mensch kann man sich halt auch oft des Eindrucks nicht erwehren, dass man sagt, für die Kinder ist das Wichtigste ihr Handy. Ja. Also, so ein Vorurteil, stimmt das auch? Also, wenn du sagst Geige lernen, denkt man, ein großartiges Kind will Geige lernen. Ich habe manchmal das Gefühl, es geht mir auch, ich will mehr Handyzeit.-Also, wenn ich in der Früh in der U-Bahn sitze, sehe ich kein einziges Augenpaar. Und da sitzen nicht nur Kinder. Also, ich glaube, dass das Handy einfach ein wesentlicher Faktor im Leben jedes Menschen ist. Also, wenn ich mir überlege, ich vergesse mein Handy zu Hause, fühle ich mich auch unwohl, weil es könnte ja wer was wollen. Ja. Wir sind einfach jetzt gedrillt auf permanente Erreichbarkeit. Man kann in der Sekunde alles googeln, man kann die Welt erreichen mit drei Klicks am Handy. Das ist jetzt so. Und na gut, wenn wir das machen, warum sollen es die Kinder nicht machen? Und die haben natürlich auch in der Corona-Zeit, aber nicht nur, haben sie gelernt, dass ein Handy einfach ein gutes Kommunikationsmittel ist. Die durften nicht raus, die durften keine Freunde treffen. Na ja, was macht man? Sie haben telefoniert. Und da jetzt zu sagen, hey, ihr habt eine coole Strategie gefunden, mit Menschen in der ganzen Welt zu kommunizieren, aber jetzt ist aus. Jetzt machen wir das nicht mehr, ist ein wahnsinniger Einschnitt. Ich glaube, das Handy ist dann ein Problem, wenn es einfach nichts anderes mehr gibt. Ja. Ein Kind, das in die Schule geht, das Freunde trifft und das bei der Wahl, gehe ich jetzt raus und treffe meine Freunde oder bleibe ich noch vier Stunden am Handy hängen, wenn ich schon zwei Stunden dran war. Das dann sagt, ich bleibe am Handy, da ist dann das Problem da. Aber solange die Kinder alternative Beschäftigungsmöglichkeiten kennen, haben und diese auch Ja, ist ein Handy ein Handy? Ja, ist Und das wird es in ihrem Leben immer geben, weil das gibt es halt jetzt. Das gab es früher nicht, jetzt ist es da und es ist gekommen, um zu bleiben. Und es wird immer Teil unseres Alltags sein.-Sprichst du Zeitempfehlungen aus, je nach Altersstufe?-Das ist eine schwierige Frage, Zeitempfehlungen. Ich finde eher, dass ein Handy etwas ist, was man sich verdienen muss. Also ich erkläre es auch meinen Kindern, ein Handy ist kein Grundrecht. Wenn man, da sind wir jetzt wieder beim Leisten natürlich. Aber wenn ich meine Sachen erledigt habe, dann kann ich mir Zeit gönnen für Dinge, die ich gerne tue. Wenn das für das Kind das Handy ist, dann soll es so sein. Ich als Erwachsener entscheide für mich ja auch, wow, okay, jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet, ich habe alles erledigt, die Wäsche ist aufgegangen, gekocht habe ich auch. Jetzt darf ich, keine Ahnung, ins Kino gehen. Das mache ich dann gern, das ist etwas, was ich gern tue, das darf ich mir dann auch erlauben. Also finde ich, kann man einem Kind auch erlauben, dass er einen harten, und Schultage sind wirklich teilweise sehr hart, einen harten Arbeitstag, Schultag hatte, dass dieses Kind sich dann auch etwas gönnen darf. Natürlich, wenn es ein Problem wird, und sobald es ein Problem ist, ist es einfach wirklich schwierig, das auch wieder wegzukriegen. Dann muss man natürlich dagegen steuern.-Vielleicht noch zwei Punkte, also einerseits für Eltern, was kann man machen. Was wir schon auch immer empfehlen ist, gerade wenn Kinder noch sehr klein sind, auch mit Handy- und Bildschirmzeiten schon auch aufzupassen. Also wir sehen schon, dass viele Kinder schon sehr, sehr früh sehr viel Bildschirmzeit haben. Das heißt jetzt auch im Kleinstkind-Alter vielleicht schon da einen Bildschirm immer dann in die Hand gedrückt bekommen. Und das ist auch, also da gibt es auch wirklich Studien dazu, dass die Langzeitfolgen sehr negativ sein können auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Das heißt da Bewusstsein zu schaffen auch für die Risiken, die es mit sich bringt. Und eigentlich hat das auch viel mit Kinderrechten zu tun. Also dass man Kinder und Jugendliche, oder in dem Fall Kleinstkinder, auch davor schützt, zu früh so viel Bildschirmzeit zu haben. Das ist schon etwas, das kinderrechtlich relevant ist und wo es auch noch Bewusstseinsbildung bedarf. Da kann schon jeder was machen. Also einerseits selber, wenn man ein Kleinstkind hat, nicht den Bildschirm als Ablenkung verwenden. Und andererseits auch vielleicht, wenn das jemand im Umfeld tut, muss ja nicht immer konfrontativ sein, aber man kann vielleicht im Gespräch darauf hinweisen, dass das nicht die beste Methode ist und wie gesagt, da gibt es Studien, dass das wirklich sehr negative Auswirkungen haben kann. -Das ist ein gefährliches Gespräch, das du da vorschlägst.-Ja, aber ich würde sagen, das ist schon unsere Verantwortung auch den Kindern gegenüber. Weil das ist genau das, was eben so das Spannungsverhältnis ist von den Rechten von Kindern und Jugendlichen. Sie können sich in dem Alter auf jeden Fall nicht für ihre eigenen Rechte einsetzen. Und da braucht es einfach auch unser gemeinsames gesellschaftliches Bewusstsein, ein bewusstes Handeln und auch eine gewisse Art von Haltung. Wie gehe ich mit Kindern und Jugendlichen, mit ihrem Recht auf Entwicklung und Entfaltung um? Wie gesagt, das Spannende, das ist wieder das Nette an Kinderrechten, es ist viel Dialog. Es ist viel, wie gesagt, es ist viel im Austausch, viel auch irgendwie schauen, was ist in der jeweiligen Situation von dem Kind, von der Familie, von der Konstellation, in dem das Kind ist, eine gute Herangehensweise. Also es geht auch nicht darum zu sagen, genau so muss es sein. Aber ja, das ist wichtig. Und vielleicht das Zweite noch, auch was allgemein und auch was quasi die digitale Nutzung angeht, also Handy und alles andere, sich zu interessieren, was das Kind im digitalen Raum macht. Also was das Kind mit dem Handy macht, was das Kind auch, weiß nicht, jetzt am Computer, Playstation oder sonst irgendwas macht. Das ist schon was, was helfen kann, auch für die Beziehung von Kindern und Jugendlichen zu den Eltern. Also ehrliches Interesse zu zeigen. Nicht nur sagen, na, jetzt leg dein Handy weg, sondern vielleicht dann irgendwann zu schauen, aha, was machst du da eigentlich? Warum findest du das gerade so cool? Was ist irgendwie, was begeistert dich? Und wie kann da ein Weg gefunden werden, dass du eben auch im digitalen Raum, kann man nämlich Hobbys haben und kann irgendwie Sachen lernen. Und wenn man da einen guten Weg findet, glaube ich, ist das meistens die beste Herangehensweise, so quasi sich davor zu verschließen, dass Kinder und Jugendliche eben auch, auch ihren Hobbys und Interessen nachgehen, auch im digitalen Raum.-Ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, wie es funktioniert und wie man es gescheit nutzt für Dinge, die wichtig sind. Und nicht nur permanent einen TikTok-Kanal verfolgt oder so. Also es kann ja ein Handy durchaus auch was Hilfreiches und Nützliches sein. Man kann wirklich viele Dinge damit erforschen und auch, eben wie gesagt, mit vielen Menschen in Kontakt treten. Das ist ja alles auch gut und schön. Ja. Aber es sind eben nicht nur die Vorteile. Und ich habe natürlich nur über meine Zielgruppe gesprochen, dass die ganz Kleinen, dass es da Bildschirmzeiten geben muss, beziehungsweise am besten gar keine Bildschirmzeiten.-Noch so ein Erwachsenenvorurteil. Die jungen Leute heutzutage wollen nichts mehr leisten. Die wollen sich nicht anstrengen. Hört ihr das immer wieder? Ich habe schon den Eindruck, dass die wollen eh nicht arbeiten, so in die Richtung.-Also natürlich ist das ein Thema, das man immer wieder hört. Ich meine, einerseits jetzt auch in einem Arbeitskontext, wenn es um Gen Z geht, weil Gen Z ist ja auch eigentlich schon in einem Arbeitskontext unterwegs. Aber natürlich auch davor. Ich glaube, das erinnert sich wahrscheinlich jede Person, dass die Vorgängergeneration oder Vorgängerinnen-Generation gesagt hat, na, die machen nicht so viel oder bei uns war, wir waren da schon nochmal angepasster, braver, was weiß ich. Also ich glaube, dieser Diskurs, dass man dann schaut, na, die sind irgendwie komisch, vielleicht, wenn man es so platt formulieren will. Das gab es immer. Und ich glaube, vorher wurde das eh sehr gut beantwortet mit Kindern und Jugendlichen, haben in ihrem Aufwachsen eigentlich sehr viel Druck, würde ich sagen. Das zeigen auch alle Studien. Und sie machen sich auch sehr, sehr viel Druck. Also insofern, dass sie nicht irgendwie arbeiten wollen, dass sie keine Interessen haben oder so, das kann ich gar nicht in dem Sinn sehen. Ähm. Es ist manchmal, was schon natürlich geworden ist, die Welt ist für Kinder und Jugendliche schnelllebiger geworden. Das heißt, Interessen und quasi Ziele können schon immer wieder vielleicht auch schneller wechseln. Da ist auf der einen Seite eben die Förderung von den Interessen und von wirklich den Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen wichtig aus einer Erwachsenenperspektive. Und dass wir auch strukturelle Möglichkeiten schaffen, wirklich die Kinder in ihren Kompetenzen auch zu stärken und in ihren Interessen. Und auf der anderen Seite auch irgendwie damit umzugehen, dass Kinder und Jugendliche vielleicht viele Sachen flexibler machen, weil sie es einfach auch so gewohnt sind.-Wenn ich auch noch kurz antworten darf, ich tue mir da sehr schwer, das zu pauschalieren. Weil dann könnten wir auch sagen, alle Erwachsenen wollen nicht arbeiten. Also wenn ich mir viele Leute anhöre, die jeden Tag jammern, dass sie in die Arbeit gehen müssen, die wollen auch nicht arbeiten. Es gibt extrem viele Kinder und Jugendliche, die total motiviert sind, die wirklich reinhackeln. Und da sehe ich jetzt auch ganz viele Kinder im AHS-Bereich, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, die sich einfach wirklich doppelt und dreifach anstrengen müssen. Die aber so reinbeißen, damit sie ja die Matura schaffen und dann irgendwie was Gescheites werden. Also gescheit im Sinne, was man halt so unter gescheitem Job versteht. Oder einfach was machen, was sie gerne machen. Und es gibt natürlich welche, die zart sind nicht. Dann ist halt immer die Frage, warum haben die keine Motivation? Wo liegt das? Wo liegt das Problem? Haben die das so gelernt? Sind die Eltern vielleicht auch so, dass sie sagen, sie arbeiten nicht gern? Oder sind es einfach wirklich mal psychische Beeinträchtigungen? Sind die nicht einfach faul, sondern depressiv? Und wenn man da genauer hinschaut, dann findet man manchmal was. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass es zu wenig Leute gibt, die genau hinschauen, warum tun die Kinder nichts. Sondern einfach einen Stempel drauf nehmen, mit fauler Sack. Und dann war es das. Und das ist das Gefährliche. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut und die ein bisschen an der Hand nimmt und sagt, okay, wo sind deine Fähigkeiten? Wo sind deine Interessen? Was willst du machen? Dann wird wahrscheinlich viel mehr rausschauen, als wenn man sie einfach abstempelt und sagt, naja, ist wieder so ein fauler Mensch, der halt nichts hackeln will.-Und man muss auf Kinder in München eingehen. Ich glaube, das ist eh das, was du auch gesagt hast. Und ich glaube, das ist das, was wir. Ich meine, es passiert eh in vielen Settings. Also ich würde auch gar nicht das so zeichnen, dass das alles noch ganz. Es ist ja nicht neu. Es passiert auch nicht nie. Aber das ist das, was man sich in allen möglichen Settings, sei es jetzt privat, aber sei es auch auf struktureller Ebene, immer wieder vor Augen führen muss. Man muss Räume schaffen. Man muss auf Kinder in München zugehen. Und man muss sich in ihre Perspektive vielleicht hineinversetzen. Man muss vielleicht Sachen auch so spannend machen, dass es sie interessiert. Also das ist auch eine Aufgabe, die man als erwachsene Person vielleicht dann auch hat, muss man sagen, in dieser Rolle, ihnen das Recht auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung zu ermöglichen. Also wird auch nicht immer gelingen. Also ich finde, ja, das ist auch nicht immer so. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, da werden wir nicht immer extrem, wie soll man sagen, beeindruckt, wie viel man von Kindern und Jugendlichen dann auch lernen kann, wie viel sie wirklich schon extrem gut durchblickt haben und welche Ideen, Perspektiven sie einbringen können zu den Themen, wo man es vielleicht wirklich gar nicht erwarten würde.-Da wären wir dann wieder bei der Partizipation. Ja. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Wien hat jetzt hier eine neue Kinder- und Jugendstrategie. Magst du uns mal erzählen, worum es da geht? Warum gibt es die? Was sind denn die Kernpunkte, die da so drinstehen?-Die Kinder- und Jugendstrategie soll im Endeffekt ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche auch strukturell mitgestalten können und dass die Stadt auch aus Kinderrechts- oder Kinder- und Jugendlichenperspektive planen kann. Das heißt, es gab jetzt schon eine Kinder- und Jugendstrategie. Jetzt gerade beginnt die zweite Kinder- und Jugendstrategie. Und im Endeffekt geht es darum, herauszufinden, was sind die Themen, die Kinder und Jugendliche in Wien jetzt gerade am meisten beschäftigen? Was sind die Handlungsoptionen, die die Stadt hier hat? Also welche Maßnahmen kann die Stadt hier setzen, um den Interessen und auch den Rechten von Kindern und Jugendlichen noch besser gerecht zu werden? Und das Spannende ist, dass Kinder und Jugendliche eben auch da mitgestalten können, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden können. Also das ist jetzt wirklich auch eine große Bandbreite. Bei der ersten Kinder- und Jugendstrategie gab es, glaube ich, ich meine, 193 Maßnahmen, also ungefähr. Und jetzt bei der zweiten Version der Kinder- und Jugendstrategie ist man darauf übergegangen, ein bisschen konkreter zu sein, also quasi sich nicht so eine Breite eine ganze Palette an Maßnahmen vorzunehmen, sondern konkreter hineinzugehen, welche Themen man eben in periodischen Abständen für Kinder und Jugendliche umsetzen will. Und das spielt sich, wie gesagt, vom Thema Freizeit über das Thema Verkehr, über das Thema Sicherheit, über das Thema Klima, also wirklich alle möglichen Bereiche, die da für Kinder und Jugendliche in ihrem Leben relevant sind, ab.-Sicherheit hast du schon angesprochen. Basis ist da ja eine IFES-Studie. 64 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen fühlen sich in der Stadt sehr sicher oder sicher. Im Alter von 16 bis 17 Jahren sinkt dann dieses Sicherheitsgefühl auf 43 Prozent insgesamt. Woran könnte denn das liegen und was können wir denn da tun dagegen?-Ich glaube, es liegt wahrscheinlich daran, dass die 16-, 17-Jährigen sich dann öfter alleine auch unterwegs befinden und da vielleicht hin und wieder in Situationen geraten, wo sie sich einfach hilflos fühlen. Oder wo sie einfach noch keinen Plan haben, was mache ich, zum Beispiel, wenn neben mir jemand geschlagen wird. Ich finde, das sind so Dinge, die sollte man in der Schule aufgreifen. Das ist etwas, was in der Schule viel zu wenig aufgegriffen wird und viel zu wenig vorkommt, so etwas wie Zivilcourage, aber auch einfach Handlungstools in Alltagssituationen. Wie reagiere ich? Was mache ich? Rufe ich die Rettung oder rufe ich die Polizei oder suche ich einen Erwachsenen und bitte den, dass er Hilfe holt? Das sind so Alltagsthemen, die aber viel zu wenig behandelt werden. Und ich wäre natürlich auch total dafür, dass es vor allem für Mädels, aber auch für Jungs Selbstverteidigungskurse gibt, weil nichts besser wirkt, als wenn ich selber das Gefühl habe, ich kann mich verteidigen, wenn ich mich unsicher fühle in einer Situation. Das wäre ein Wunschtraum.-Aber so quasi zum Beispiel auch in der Burschenarbeit zum Beispiel, aber auch Mädchenarbeit, dass man auch quasi da gestärkt wird in der eigenen, wie man die Situationen, mit denen man konfrontiert ist, einfach gut meistern kann. Und ein zweiter Aspekt, den ich schon nicht unterwähnen lassen wollte, was eigentlich alle in der Stadt und alle verschiedenen Stellen in der Stadt tatsächlich machen könnten, sind Kinderschutzkonzepte zu entwickeln. Also wir als Kinder- und Jugendanwaltschaft haben das jetzt als Thema aufgenommen, wirklich zu versuchen, dieses Thema Kinderschutzkonzept, für alle möglichen Bereiche so runterzubrechen, dass sie wirklich praktisch anwendbar sind. Das heißt, was heißt das? Ich kann mich dann zum Beispiel fragen, für meinen Arbeitsbereich, wir haben mit den Wiener Bädern zum Beispiel zusammengearbeitet, wie kann ich die Wiener Bäder im Zusammenhang mit Kinderschutz, also Gewaltschutz ist es eigentlich, sicherer machen. Das ist sowas wie Schulen. Das heißt, die Personen, die dann vor Ort arbeiten, haben ein besser geschultes Auge dafür, wo man vielleicht hinschauen muss, wo man vielleicht aufpassen muss, welche Situationen vielleicht besonders heikel sein können, sage ich jetzt einmal. Das zweite ist, wie gehe ich damit um, mit den Situationen, die ich dann vielleicht wahrnehme. Also zum Beispiel Ruhe bewahren, klare Handlungsabläufe zu haben, wirklich vielleicht Personen zu haben, die sich noch ein bisschen mehr im Detail auskennen, wen man anrufen kann und muss. Also diese Settings zu schaffen, in denen Leute aufmerksam sind, handlungsfähig sind und dann quasi ein Prozess haben, wo es danach läuft, wo die wirklich zuständigen Stellen aktiv werden können. Das kann eigentlich jede Dienststelle für sich machen. Und da geht es einerseits um die Erfüllung der Aufgaben. Also wie gesagt, wir haben auch mit Wiener Wasser zum Beispiel zusammengearbeitet. Die haben das für ihre Veranstaltungen jetzt umgesetzt. Also unter anderem, wie kann man Veranstaltungen aus einer Kinderschutzperspektive noch besser gestalten und eben den Kinderschutz griffig machen in dem Bereich. Aber auch zum Beispiel, wie gehen wir auch mit jungen Menschen um, die in der Stadt Wien arbeiten. Also auch da sich quasi zu überlegen, wie kann man da Konzepte schaffen. Worum es dabei geht ist, einfach nur sich selber in der jeweiligen Rolle zu reflektieren. Wie kann ich ein sicheres Umfeld für Kinder und Jugendliche schaffen? Und ganz einfache praktische Wege zu finden, das auch umzusetzen. Und das geht und ich finde es vor allem extrem spannend, wie man das in den unterschiedlichen Bereichen schaffen kann. Und auch die Rückmeldungen immer zu bekommen. Hey, in den Fällen hat es wirklich geholfen. Also es hat dann echt Handlungssicherheit gegeben und man konnte Kinder schützen. Das ist echt cool, wie das funktionieren kann.-Das ist so eine konkrete Auswirkung von dieser Kinder- und Jugendstrategie.-Genau.-So kann es sich dann zeigen. Ein anderer Punkt, den es die Kinder ja sehr wünschen ist, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt vielleicht auf einen zweiten weiteren Punkt, sonst wären wir zu lang. Für Kinder ist es sehr wichtig, ist der öffentliche Verkehr. Und was sie sich auch immer sehr wünschen, ist mehr, je nach Alter der Kinder, mehr Spielplätze, mehr Grünraum. Wie kann man denn da oder wie nimmt denn die Stadt da Einfluss und sagt, da machen wir es besser für die Kinder?-Ich meine, es gibt da auch verschiedene Mechanismen. Das eine ist, und das finde ich eigentlich sehr cool, was schon passiert ist, es gibt in sehr vielen, würde ich sogar fast sagen in den meisten Bezirken, Bezirksparlamente für Kinder und Jugendliche, wo sich Kinder und Jugendliche in ihrem Bezirk strukturell damit auseinandersetzen können, wie zum Beispiel Freizeitangebote besser ausgestaltet oder erweitert werden können, welche Dinge begrünt werden können. Also wirklich im Bezirk diese Kinder- und Jugendparlamente zu fördern, vielleicht auch Kinder und Jugendliche darauf aufmerksam zu machen, dass es eben diese Kinder- und Jugendparlamente gibt. Und dort mitzugestalten, das ist etwas, das sinnvoll ist aus unserer Sicht und das ist auch wirklich cool. Funktioniert. Das zweite ist, dass eigentlich auch alle Dienststellen da wieder Partizipationsprojekte machen können, wo sie quasi auch wieder in ihrem eigenen Umfeld schauen können, wie kann ich Kinder und Jugendliche einbeziehen, wenn ich zum Beispiel Stadtplanung mache oder so. Passiert eh auch oft, muss man sagen. Also da haben super Partizipationsprojekte schon immer wieder umgesetzt. Wie kann ich Kinder und Jugendliche in all diese größeren Prozesse noch mit einbeziehen? Wie kann ich die Interessen da gut abholen? Das sind Dinge, die man noch weiter anschauen kann. Und das andere ist, woran wir jetzt auch gerade arbeiten, ist so eine Art Kinder- und Jugend-Mainstreaming zu schaffen. Also es ist immer ein bisschen technisch und vielleicht klingt es ein bisschen fad im ersten Moment, aber wir haben solche Mainstreaming-Instrumente eigentlich in anderen Bereichen auch. Zum Beispiel ganz bekannt Gender-Mainstreaming, aber auch Klima-Mainstreaming gibt es eigentlich schon. Und da beim Mainstreaming-Prozess geht es ja darum, von Anfang an eine gewisse Perspektive in der Planung einzunehmen. Und das aus Kinderrechtsperspektive, also aus Perspektive von Kindern und Jugendlichen zu stärken, sehe ich auch als eine spannende Möglichkeit, wie man als Dienststelle oder als jede Stelle in der Stadt eigentlich für Kinder und Jugendliche noch gezielter planen kann.-Das Beste rausholen kann für die Kinder.-Genau, wenn man so sagen will.-Ich werde noch ganz gern kurz das Thema Mobbing anschneiden, weil ich glaube, das ist gerade in den Schulen ein Riesenthema. Wie viele Kinder und Jugendliche sind denn da betroffen? Wie kann denn das ausschauen? Erzählst du uns ein bisschen was darüber über das Thema?-Also ich habe jetzt da keine absolute Zahl. Es betrifft immer wieder Kinder und ich finde, jeder Fall ist individuell anders und man muss immer genau drauf schauen.-Gibt es in jeder Schulklasse wahrscheinlich, oder?-In jeder würde ich nicht sagen, ja. Es gibt sicher immer wieder Kinder, die sich schlecht behandelt fühlen. Ob es dann Mobbing ist oder nicht, ist wieder dahingestellt. Aber wenn sich ein Kind gemobbt fühlt, dann muss man de facto hinschauen. Wurscht, ob es dann so ist oder nicht. Das Kind braucht dann Unterstützung und die anderen in der Klasse vielleicht auch. Es ist sehr unterschiedlich. Manchmal kommen Kinder zu mir. Manchmal kommen Eltern und sagen, mein Kind wird gemobbt. Ich finde, es ist immer wichtig zu schauen, was liegt dahinter? Wo kann man unterstützen? Mit wem muss man sprechen, damit man in dem Thema weiterkommt? Es ist kein Fall wie ein anderer. Und man muss da, glaube ich, sehr individuell vorgehen.-Was macht es mit einem Kind?-Was macht es mit deinem Kind? Verunsicherung, Angst, Trauer, Wut. Das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Definitiv Kränkungen, die tief gehen. Und dann ist es wichtig, dass mal wer hinschaut und sagt, hey komm, da müssen wir jetzt was tun. Und wir gehen das jetzt an.-Die Eltern, die Lehrer.-Die Eltern, die Lehrer, manchmal auch Freunde. Manchmal gibt es ja in der Klasse dann den einen oder anderen, der aufsteht und sagt, hey, hör jetzt auf. Lass ihn jetzt in Ruhe. Und der dich dann an der Hand nimmt und sagt, wir gehen jetzt zum Direktor, zum Lehrer, zu wem auch immer und lassen uns helfen.-Und es gibt eine neue Broschüre, habe ich gesehen, zum Thema.-Genau, wir haben eine Broschüre mit vielen Expertinnen und Experten gemeinsam gestaltet, wo eben solche ganz praktischen Tipps gegeben werden. Auch ein Plakat, das in allen Schulen jetzt aufgehängt sein sollte. Also da kann man mal schauen, ob es überall wirklich auch hängt, das Plakat. Wo in einfachen Schritten erklärt wird, wie kann man eben Mobbing zuerst einmal, so gut es geht, verhindern. Und wenn Mobbingfälle aufkommen, wie kann man damit umgehen. Als Lehrperson, als Elternteil. Genau, und dann auch natürlich als Unterstützung für Kinder und Jugendliche. Da sind jetzt eh schon sehr viele gute Sachen gekommen, aber Hinhören, ein gutes Klima auch schaffen, vielleicht auch ein gutes Gruppenklima, Klassenklima schaffen, solche einfachen Sachen sind da auch schon drinnen. Und ja, auch Mobbingprävention als gesamte gesellschaftliche Aufgabe zu sehen. Also jede Person kann da auch dazu beitragen, Mobbing so gut es geht eben nicht aufkommen zu lassen.-Ihr zwei arbeitet ja jeden Tag mit Kindern und Jugendlichen. Gibt es eine Sache, die sagt, das würde ich meinem eigenen jungen Ich raten, wenn ich jetzt sage, der zehnjährige Sebastian oder die zehnjährige Clara, überleg mal, oder mach so, oder das wäre jetzt mein Hinweis?-Ich glaube, ich würde meinem zehnjährigen Ich sagen, denk an deine Stärken, hör auf deine innere Stimme, mach das, was du kannst und was du möchtest und wo du dich gut fühlst. Und wenn es mal nicht weitergeht, dann sei stark genug, dass du dir Unterstützung holst, weil Unterstützung holen ist keine Schwäche, sondern eine der größten Stärken.-Da kann ich mich wieder anschließen. Und das sollte vielleicht auch schauen, Sachen zu finden, an denen man Freude hat. Also das hängt mit den Stärken auch zusammen natürlich und auch Sachen zu finden, oder wirklich dem auch nachzugehen, was Spaß macht und auch da zu schauen, wie man irgendwie da eine gute Zeit verbringen kann und auch trotzdem weiterkommen kann. Weil oft die Sachen, die man gern macht, wird man dann auch vielleicht gut machen können. Und da Wege zu finden und sich auch irgendwie Leute zu holen, die einen dabei unterstützen können.-Danke euch. Danke für das Gespräch und für den Besuch im Studio bei mir.-Danke für die Einladung.-Zu Gast bei Christine Oberdorfer waren Clara Steinkogler-Kieslich und Sebastian Öhner.
Podcasts we love
Check out these other fine podcasts recommended by us, not an algorithm.

Grätzlgeschichten
Stadt Wien
büchereicast
Stadt Wien - Büchereien
Wiener Wohnen Podcast
Wiener Wohnen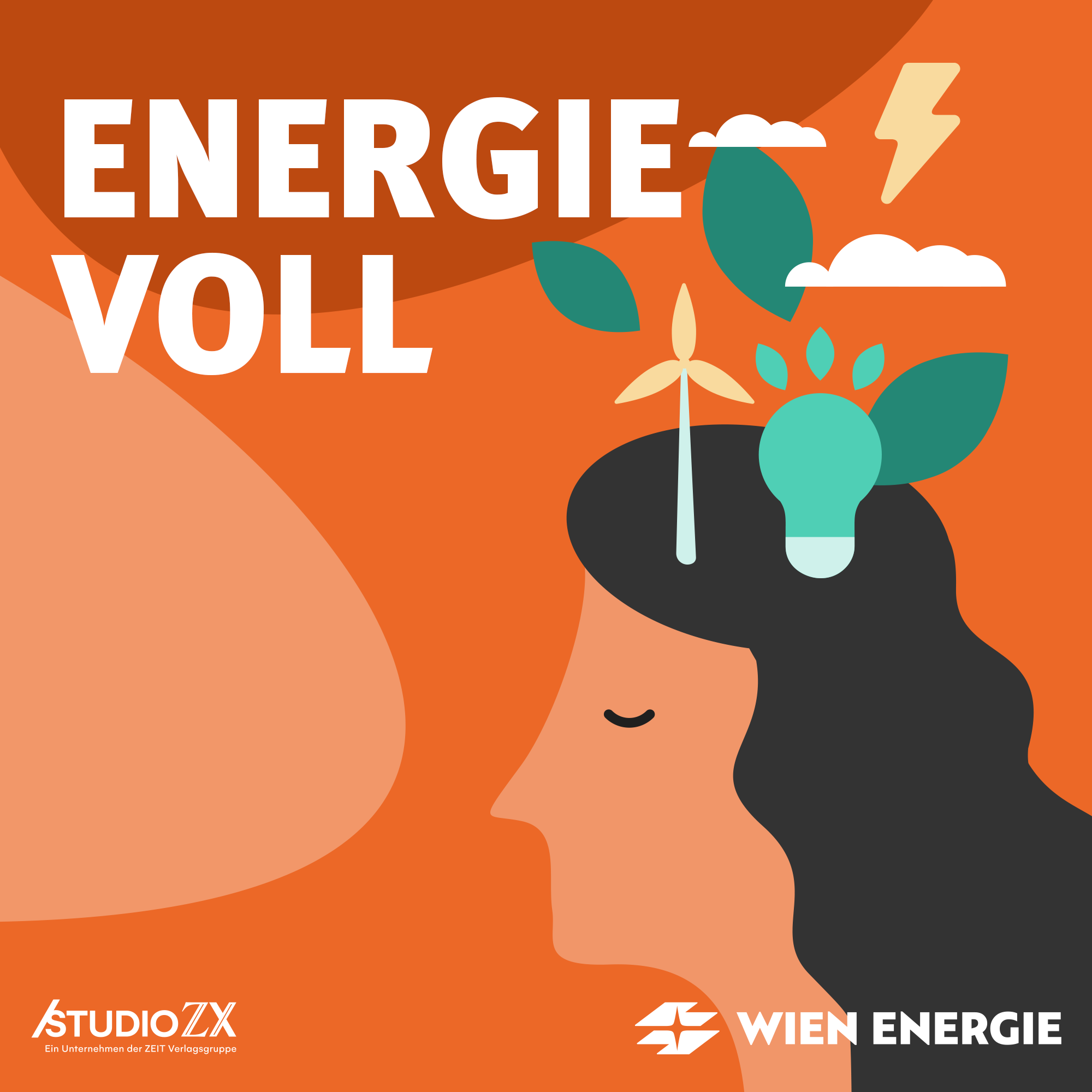
Energievoll
Wien Energie, Studio ZX