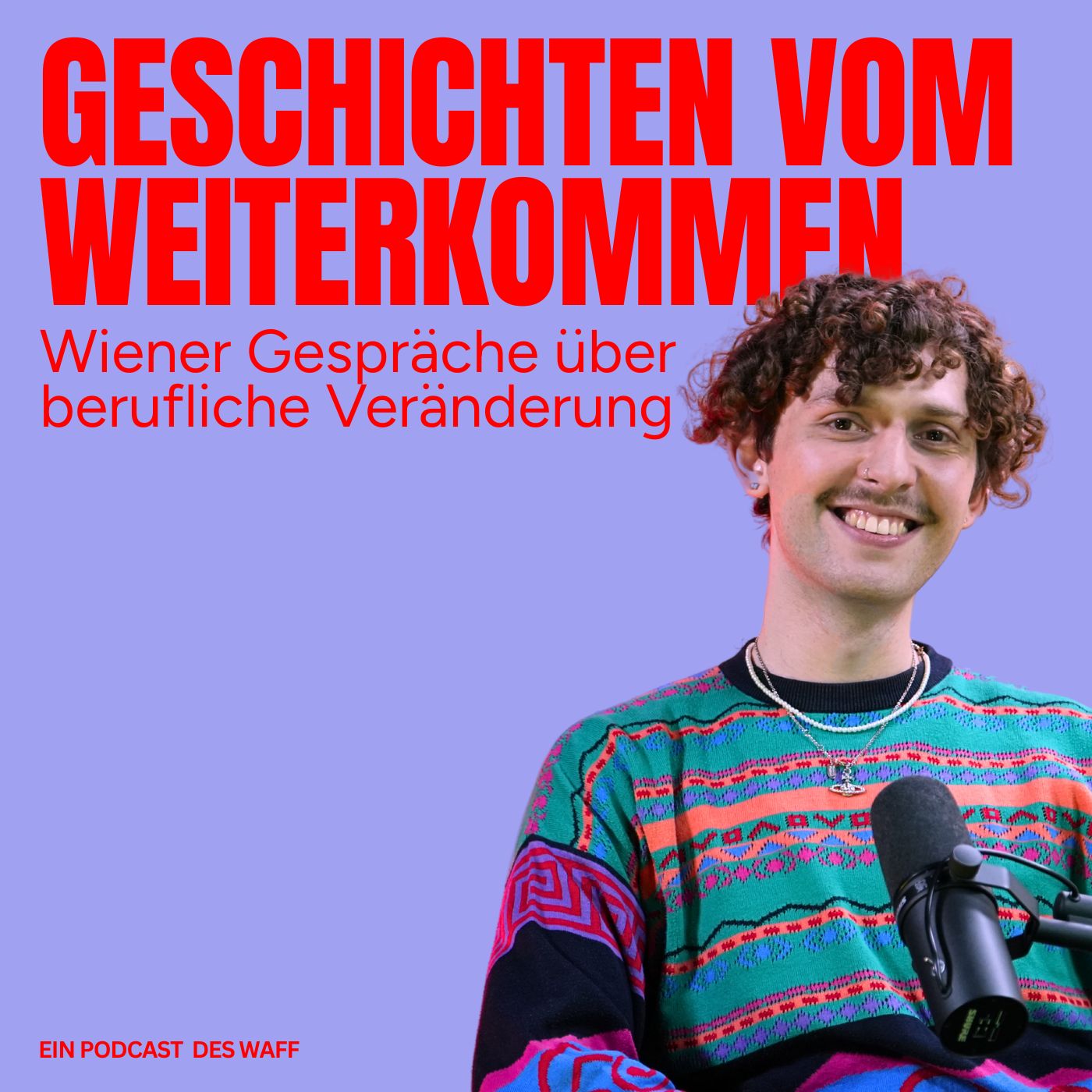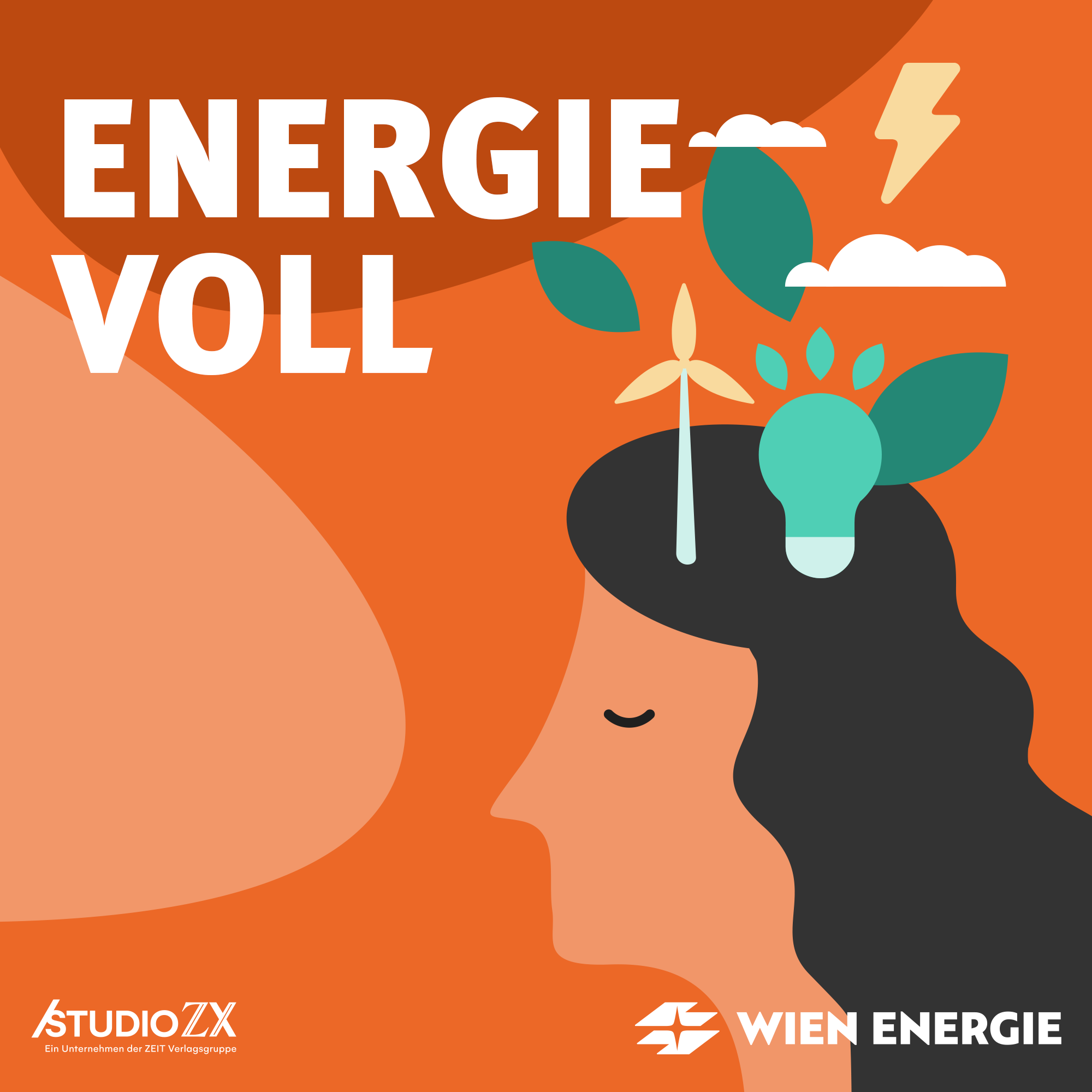Stadt Wien Podcast
Stadt Wien Podcast
Zum 8. Mai: Zeitzeuge Lutz Elija Popper im Gespräch
Lutz Elija Popper wurde 1938 als zweiter Sohn eines jüdischen Arztes in Wien geboren. Die Familie emigrierte nach Bolivien und kehrte 1947 zurück. Im Gespräch mit Barbara Kedl-Hecher erzählt Popper von der Verteibung seiner Eltern, der Kindheit in Bolivien, den Herausforderungen des Wiener Alltags nach der Rückkehr und über seine Arbeit als Zeitzeuge in Schulen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert (falls ihr das noch nicht gemacht habt).
Feedback könnt ihr uns auch an podcast(at)ma53.wien.gv.at schicken.
Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen:
https://www.facebook.com/wien.at
https://bsky.app/profile/wien.gv.at
https://twitter.com/Stadt_Wien
https://www.linkedin.com/company/city-of-vienna/
https://www.instagram.com/stadtwien/
Und abonniert unseren täglichen Newsletter:
http://wien.gv.at/meinwienheute
Weitere Stadt Wien Podcasts:
- Historisches aus den Wiener Bezirken in den Grätzlgeschichten
- büchereicast der Stadt Wien Büchereien
-Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute ist Zeitzeuge Lutz Elija Popper bei Barbara Kedl-Hecher zu Gast.-Lieber Herr Lutz Elija Popper, danke für Ihren Besuch in unserem Studio. Österreich gedenkt heuer zum 80. Mal dem Kriegsende, dem Beginn der Zweiten Republik und 70 Jahre Staatsvertrag. Wir haben Sie eingeladen, weil Sie eine sehr schicksalhafte Familiengeschichte zu erzählen haben, die Sie als Zeitzeuge auch an Jugendliche in Wiener Schulen weitergeben. Wenn ich kurz zusammenfassen darf. Sie wurden am 1. März 1938 als zweiter Sohn eines jüdischen Vaters und einer arischen Mutter in Wien geboren. Ihr Vater, der Arzt Ludwig Popper, musste bald nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten in die Schweiz emigrieren. Währenddessen ist Ihre Mutter Friederike Popper, die als Krankenschwester gearbeitet hat, mit zwei kleinen Kindern, Ihnen und dem um zwei Jahre, älteren Bruder Peter, in Wien verblieben. Die beiden haben getrennt voneinander versucht, die Ausreise zu schaffen. Es war ja nicht so wie heute, dass man im Internet nachschaut, was einen erwarten könnte, sondern es war gespickt von behördlichen Schikanen und vor allem eine Reise in eine ungewisse Zukunft ohne Freund*innen, ohne Familie, ohne Sprachkenntnisse, ohne finanzielle Mittel. Was von diesen einschneidenden Erlebnissen der Vertreibung aus einem bis dahin erfolgreichen, ökonomisch komfortablen Medizinerleben in ein unbekanntes Land mit Entbehrungen wurde in Ihrer Familie erinnert?-Ich muss dazu wirklich bemerken und klarstellen, es gab für meine Familie in diesen Zeiten, wo eben mein Vater geboren wurde, von 1904 bis zu unserer Vertreibung, es gab keine Zeit, wo ein komfortables Leben, auch kein Medizinerleben möglich gewesen wäre. Die Situation der Juden vor 1938 war hier in Wien ganz besonders auch schon wirklich prekär. Es hat sich schon über die Jahrzehnte davor, diese antisemitische Stimmung, auch dank des Herrn Lueger, der damals Bürgermeister war, Anfang Neunzehnhundert, hat wesentlich dazu beigetragen, dass da immer wieder ein Input erfolgt ist von den Politikern in Richtung des Unwertes oder des Schadens, den Juden für eine Gesellschaft bedeuten. Es war eigentlich schwierig und vor allem auch deswegen, weil es ist für Juden, die die überwiegende Mehrheit der Ärzte in Wien, auch in ganz Österreich, darstellten. Das waren 5. 000 Ärzte insgesamt, von denen waren 3. 200 Juden. Das hatte so eine ganz komplexe Geschichte, weil das Judentum ja immer in den letzten Jahrhunderten fast schon hat versuchen müssen, seine Kinder so zu erziehen, dass sie einen Job haben, mit dem sie einmal leben könnten, mit dem sie überleben könnten und selbständig werden könnten, weil die Berufe, also Jobs im öffentlichen Bereich für Juden waren eine Rarität. Wir hatten sowas sogar. Einer der Onkel meines Vaters war vor 1938 der Chef des Hauptzollamtes in Wien, ein jüdischer Hofrat. Aber das war wirklich eine Ausnahme. Das war nicht das Übliche. Grundsätzlich waren in allen öffentlichen Bereichen natürlich die Juden als Außenseiter, als Fremde, als Leute, die hier den Österreichern die Jobs wegnehmen würden oder die sie betrügen würden, sehr verschrien. Alles, was mit Geld zu tun hatte, wurde automatisch mit den Juden quasi gleichgesetzt. Wobei die Juden natürlich auch auf diesem Sektor eine besondere Ausbildung gehabt haben. Sie sind ja schon zu Rothschilds Zeiten eine ausgesuchte Gruppe gewesen, die bei einem der Juden, in Frankfurt hat er gelebt, diesen Ruf noch bestärkt hat. Aber das Problem war nämlich, dass der zunehmende finanzielle, menschliche Verkehr der Bevölkerung innerhalb Europas, ohne die Vermittlung durch finanzielle Tauschmöglichkeiten, gar nicht funktioniert hätte. Es war halt einfach so. Das war für die Juden damals in Wien ganz typisch. Es gibt sogar eine Geschichte, die mir mein Vater immer wieder erzählt hat, weil sie so gut als Beschreibung der Situation gepasst hat, für das Schicksal der Juden. Wer Jude gewesen ist und wann er wissenschaftlich gearbeitet hat, die Universitätsprofessoren, die jüdischen, das waren insgesamt 163 oder sowas, mehr als die Hälfte von denen waren Juden. Das waren wissenschaftlich arbeitende Menschen, die, die versucht haben in ihrem Bereich Besonderes zu leisten. Das hat auch dazu geführt, dass in den Wirtschaftsbereichen die Juden auch versucht haben, die Möglichkeiten zu nutzen, einen Job zu finden. Es war ja für die Christen im Grunde, und es ist bis heute eigentlich so, das Handeln ist eine, eine, ja, naja, kein Renommee für einen christlichen Tiefgläubigen und für einen Juden auch nicht. Aber die Beziehung zum Geld war natürlich eine ganz andere, weil die Christen konnten überall Jobs haben, waren überall, sind überall in höhere Positionen aufgerückt und haben in den anderen Berufen auch Vorteile gehabt. Die Juden haben müssen suchen eine Möglichkeit, sich davon auch ein Scherzl abzuschneiden. Und das war eben die Ausbildung der Kinder. In den orthodoxen Familien vor 38 war es bitte so, dass Kinder der jüdischen, von jüdischen Eltern ab dem dritten Geburtstag, nicht Lebensjahr, ab dem dritten Geburtstag in die Schule gegangen sind. Sie waren drei Jahre alt, und dann waren sie von der religiösen Gemeinschaft dazu ausersehen, also die Chance zu haben, die Sprache zu lernen. Dazu wurden sie in Schulen, das waren die Synagogen. Die Synagogen haben im jüdischen Leben auch die Schulkassen, meistens die Schulgänge. Auch wenn man am Sonntag zusammengekommen ist mit anderen Leuten, meistens in der Schule zusammen. Und das hat also ganz sicher dazu geführt, dass die Kinder der jüdischen Familien natürlich schon in den ersten Schulklassen ab sechs Jahren ein bisschen einen Vorspruch hatten. Natürlich. Das hat ihnen nicht gut getan in der Gesellschaft. Sie waren immer so quasi die Vorzugsschüler, unter Anführungszeichen. Und das hat so, das ist ja so im ganzen System des Antisemitismus ein ganz wesentlicher Teil gewesen. Aus der ganzen, auch schon Religionsgeschichte, dass man sehr schwer dabei sich tut, zu sagen, was ist der Grund für Antisemitismus. Das wissen wir ja an sich alle miteinander nicht. Und einer der Gründe war, war dieser Drive des Judentums in Richtung bessere Ausbildung, nämlich weitere Studienausbildung, weil Studium konnte jeder machen. Waren nicht für Nichtjuden, die studiert haben. Mit der Medizin waren sie in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, waren 50 % jüdische Studenten. 50 % jüdische Studenten, in einer Zeit, wo in Wien 200.000 Juden gelebt haben und 2 Millionen davon Österreicher waren, die dort gelebt haben. Also wenn man das in Relation dazu gesetzt hat, war das eine überwiegende, und nicht nur in der Medizin, das war in der Rechtswissenschaft, das war in der Technik, das war im Wirtschaftlichen, überall sind diese jüdischen Kinder von den Familien dazu angehalten und dabei unterstützt worden, weitere Bildung zu machen, andere Bildung, sogenannte Bildung, die es ermöglicht einmal unabhängig zu sein von den Restriktionen der jüdischen Organisationen. Das war einfach so. Und mein Vater, für den ist gar nicht in Frage gekommen, irgendwas anderes zu machen, obwohl es sehr viele Händler in meiner Familie gegeben hat. Mein Großvater hat schon im Handel gearbeitet und studiert und war eine Zeit lang auch in Berlin in einer Schule. Und er hat dann weitergearbeitet und gelernt und war in Paris. Mein Großvater hat 15 Jahre seines Berufslebens in Paris zugebracht, als Prokurist in einer Bank. Die Bank hat einem der Verwandten der Familie gehört. Paris war eine höchst beliebte Stadt bei den Juden, weil dort hat der Jude das Gefühl gehabt, er ist ein normaler Mensch. Das war im mittleren Europa, im Deutschen, war das ganz anders. Und das hat die ganze Situation des Judentums sehr beeinflusst. Und mein Vater hat, also, ist in einer jüdischen Familie aufgezogen worden, die war säkular, die haben sich nicht darum geschert, was ein Synagoge und was man da macht. Mein Vater hat gesagt, er hat in seinem Leben vereinzelt bei Geburtstagen, also bei Hochzeiten oder so, eine sogenannte Kuppa mitgemacht, also diese Verheiratung in der Synagoge. Ja, aber das war alles. Und das hat auch bewirkt, dass die ganze Situation in diesen Familien eine ganz andere war, als hier bei den jüdischen, bei den gläubigen, bei den christlichen Menschen. Die hatten ja auch keinen Grund gehabt, darum zu fürchten, dass sie verhungern. Denen ist es besser gegangen natürlich, ja. Und einer der Gründe dafür, dass Israel gegründet worden ist, war der, der Gründungsjude, der in Salzburg im öffentlichen Dienst war, als Jurist. Den haben sie bei Beförderungen immer links liegen lassen, dann ist er nach Paris gegangen als Jurist und dort hat er ein bisschen Karriere gemacht und hat gegründet eine Organisation zurück nach Israel, in ein eigenes Land. Das war seine Idee, der berühmte, Herzl. Herzl hat als erster diese Organisation zuwege gebracht, die bewirkt hat, dass das ganze System einmal in so Rollen kommt und dass es so etwas gegeben hat, wie eine Sehnsucht nach einem eigenen Land. Weil die Juden sind ja 2000 Jahre nach ihrer Vertreibung aus Jerusalem, also Jerusalem, in ganz Europa herumgereist, waren in verschiedensten Gemeinden, haben also dort eigene kleine Staaten gebildet, haben eigene Gemeinden, eigene Verwaltungen gehabt. Das haben also die damaligen Machthaber, die Regierenden, die Könige, der Adel sehr respektiert, weil die Juden ihm sehr gut Steuern zahlt. Also das war ein komplexes Gemisch von Geben, Nehmen und einander, nicht umbringen, sondern das war die Welt, in der mein Vater noch aufgewachsen ist. Mein Vater hat 20 Verwandte gehabt in Wien in verschiedenen Bereichen. Eine der Tanten meines Vaters war im Wiener Gemeinderat als Abgeordnete, die Tante Adele, ich glaube Hirschenhauser hat sie geheißen. Das ist die mütterliche Seite meiner jüdischen Familie, meiner Großmutter, meine Großmutter war auch eine Jüdin, die hat Hirschenhauser geheißen. Mein Vater war Popper und die haben einander kennengelernt irgendwann einmal in Wien und Umgebung und haben zusammengefunden. So war das. Aber das ist ein bisschen viel für das, was Sie mich hier fragen. Aber ich versuche das immer ein bisschen auch in den Schulen anzubringen. Das ist nicht so. Und das haben sich auch die normalen Juden, die nicht ein bisschen deppert und arrogant waren, haben sich dazu bekannt. Wir sind nicht anders als die anderen. Wir sind nicht gescheiter als die anderen. Wir haben nur ein besseres Schulsystem am Anfang und das nutzt uns. Und die haben das weitergemacht. Und im Studium auch. Mein Vater hat erzählt, es war sehr wichtig für die Familien, dass das Familienmitglied, das Kind, das studiert, etwas studiert, das man als Brotberuf bezeichnen kann. Jurist, Ärzte, Anwälte, Wirtschaftler. Waren auch noch Linguistik oder Kinesiologie oder was. Mein Vater hat gesagt, wenn man eine Mutter gefragt hat, was das Kind studiert, und das war nicht eines dieser anerkannten Berufe, hat es geheißen Tinnefologie. An Tinnef. Ja. Tinnefologie. Hat er gesagt. In der Familie war das so. Das hat nichts genutzt. Das war nicht brauchbar. Das ist so. Natürlich ist es auch gemacht worden. Natürlich gab es Philosophen, Literaten, alles. Und großartige Leute. Die haben meistens nicht studiert, sondern haben an irgendwelchen Seitenästen ihre Karrieren gemacht. Aber das war. -Nein, ein sehr bekannter ist ja der Philosoph Karl Popper. Der auch wichtige Spuren hinterlassen hat.-Der Sir Karl Popper das war wirklich ein entfernter Cousin von meinem Vater. Sie haben sich gekannt. Bevor Karl Popper nach Neuseeland gegangen ist, haben sie einmal gemeinsam die soziale Rechtslage in Österreich versucht, ein bisschen zu beeinflussen. Mein Vater ist damals schon sozialmedizinisch interessiert gewesen, als junger Mann. Und hat also in diesen Zirkeln, die sich darum gekümmert haben, wie gefährlich ist Arbeit, was kann man machen und wie kann man die Gefahren der Arbeit usw. hintanhalten, minimieren. Das war immer ein bisschen so sein Traum. Und das hat er später auch beigehalten. Und in dieser Richtung hat er auch in seinen Jahren in Bolivien gearbeitet. Letztlich war mein Vater eine Zeit lang der Sozialmediziner in Wien. Es hat kaum andere gegeben. Der Arbeitsmediziner. Es hat welche gegeben, die nebenbei ein bisschen. Mein Vater hat wissenschaftlich auf diesem Sektor sehr viel gearbeitet. Er ist dann mit der SPÖ in Kontakt gekommen. Mein Vater war auch nach dem Krieg einer der Gesetzesmacher in den Fragen der Grundlagenwissenschaften und auch der Politik. Er hat so formuliert, artikuliert, hat Gesetze geschrieben in der ASVG sind viele Gesetze. Hat mein Vater geschrieben, die medizinischen Parts. Und hat die anderen unterstützt mit medizinischen zusätzlichen Informationen. Das hat er gemacht. Das war sein Leben.-Wieso haben Ihre Eltern nicht schon früher Österreich verlassen?-Meine Eltern gehörten zu jenen Juden, die relativ früh draufgekommen sind, dass es jetzt für sie aus ist und dass sie weg müssen. Sie haben nur nicht geglaubt, dass man. Dass man irgendwo ewige Zeiten suchen muss und nach einem Land, das Juden aufnimmt. Weil damals, wie die Nazis bei uns einmarschiert sind, die österreichischen Juden, die waren ja schon da, war es so, dass. Es war ein großes Problem, eine Möglichkeit zu finden, aus diesem Dilemma herauszukommen. Man hat vor allem nicht gewusst, und ich weiß das von meinen Eltern sehr genau, meine Eltern haben nicht gewusst, und das weiß ich, weil ich nach dem Krieg öfter mit ihnen darüber diskutiert habe, man hat nicht gewusst, dass mehr daraus wird, als die im Judentum seit Jahrtausenden bekannten Pogrome. Die Pogrome waren Standard seit Tausenden von Jahren und es gab Pogrome, wo tausende Menschen umgekommen sind, besonders in Russland. Das ist ein russisches Wort und das bedeutet also eigentlich, ein Menschhatz in einer Kommune, ist ein Pogrom. Und ja, die haben das miterlebt. Beziehungsweise die Vorfahren der Vorfahren, haben gewusst, wie das funktioniert und dass es das gibt und sie haben geglaubt, im Jahr 38, na ja, wir werden wieder unsere Watschen kriegen, ja, aber wir haben es bisher überlebt, wir werden es wieder überleben. Es hat wirklich von den Juden, die ich kannte und ich habe sehr viele nach dem Krieg kennengelernt, die Freunde meines Vaters und meiner Eltern gewesen sind, die nachher zu Besuch nach Wien gekommen sind, es ist also keiner von denen mehr, endgültig zurückgekommen, aber viele sind an Wien sehr erkränkt und da kannte ich eben welche, die jedes Jahr ein, zwei Mal gekommen sind, weil sie haben gesagt, das Herz bricht ihnen, weil das war die Heimat, das waren ja nicht Junge, so wie ich mit 16 Monaten oder was, die sind hier aufgewachsen, im Land, die waren 15, 20, die waren 30, 40, 50, 80 Jahre alt, die wollten wieder nach Hause. Das war der Traum aller Juden am Anfang, das wird, wir müssen schauen, dass wir ausweichen, lassen wir diesen Wirbel vergehen und wir kommen wieder. Es war niemand, den ich kennengelernt habe, von den jüdischen Freunden meiner Eltern, hat nachher, auch der Bericht hat gesagt. Hat gemeint, ich gehe jetzt weg und auf Zeit, damit eine Ruh' ist und dann wird schon alles besser werden, aber die Haltung war so. Also das Problem war nur das, dass sie, wenn sie aus Österreich, aus Deutschland natürlich auch, weggegangen sind, haben sie ja müssen alles zurücklassen, was ihnen gehört hat. Das war die Frage, haben wir je wieder eine Chance? Das war schon das erste große Drama, für das ganze Judentum, dass man gewusst hat, wir sind, die Verfolgungen, sind wir gewohnt, in den kleinen jüdischen Gemeinden, kleineren Orten oder so weiter, ist ja meistens sehr ruhig gewesen, aber in größeren, mittleren und größeren, Gemeinden, gab es manchmal schon Unruhe, weil 200.000 Juden, die hier in der Gesellschaft gelebt haben und ihre Geschäfte betrieben haben, das war halt manchmal unangenehm für die normale Bevölkerung und das war so, so wie es jetzt ist. Wenn irgendeiner, der hier fremd ist sozusagen, der nicht hier geboren ist, über Generationen hier lebt, sich entwickelt und zu uns kommt, dann ist das sehr problematisch, weil das ist immer ein Fremder, das ist immer ein Ausländer, das hängt uns bis heute nach. Was heute die rechtsradikale FPÖ macht, ist genau das Gleiche, was damals schon gemacht worden ist. Das ist ja alles nicht neu. Das sind ja keine neuen Erfindungen der Nazis. Die Erfindungen, die neuen waren, dass man in die Führung des Nationalsozialismus fast nur Menschen aufgenommen hat, die bereit waren weiterzugehen, als bisher, die sich entschließen konnten zu sagen, die Juden gehören eliminiert und zwar ganz. Das haben sie ja gemacht. In der Wannsee-Konferenz im Jänner, 1942 war das im Jänner, haben sie ja beschlossen, und das haben sie dokumentiert, diese Unterlagen gibt es, kennt man ja als historisch bewanderter Mensch, die haben das niedergeschrieben. Die haben so auch gesagt, wie das passieren soll. Die haben auch gesagt, wir müssen das so machen, dass das möglichst wenig auffällt. Wir, wir können also heute wirklich nur sagen, das versuche ich es den Jungen auch klar zu machen, dass wir Menschen alle gleich sind. Das ist mein, eigentlich ist das mein, mein Ziel bei jedem Besuch in einer Schule, den Schülern einmal zu sagen, egal wie alt sie sind, halt mit verschiedenen Worten, wir sind alle miteinander gleich viel wert. Wir sind die gleichen Trottel, wir sind die gleichen Gescheiten, wir sind die gleichen Künstler. Das ist ja nicht der Unterschied. Der Unterschied ist ganz was anderes. Das ist die Kultur, in der man über Jahrtausende aufgewachsen ist. Und diesen Vorzug hatten die Jüdischen schon. Also die Nobelpreisträger, die österreichischen aus der Vorkriegszeit, ich glaube, ich weiß nicht, da war der Wagner-Jauregg, ich glaube, das war der einzige Nicht-Jude, aber sonst, es war sehr viel auf diesem Sektor, auch in der Kunst, auch in der Literatur, auch in der Musik. Also das waren Leute, die nicht unbedingt aus Druck ihres Talents, sondern manchmal aus Überlebensgründen in solche Bereiche abgeschwirrt sind, die dann im Künstlerischen zum Beispiel Karriere gemacht haben. Das waren die Schauspieler. Die haben so auch geschaut, die haben musiziert, die haben Schau gespielt, die haben viel gelesen. In der Erziehung haben die jungen Juden aus der Torah, aus dem Gesetzbuch des Judentums oder vielleicht noch aus dem Talmud, so viel mitgekriegt, dass sie eben anders geformt hat als andere Menschen. Und das ist was ich auch den Schülern sage, das unterscheidet natürlich die Juden von damals, von den Flüchtlingen von heute. Weil die Juden, die damals in Europa gelebt haben, zum Beispiel hier in Österreich, die haben mit der Sprache nicht so große Probleme gehabt. Die haben sehr schnell Sprache gelernt, weil sie haben müssen, überall wo sie waren, Sprache lernen. Und sie haben versucht – und sehr erfolgreich – ihre Kinder und Kindeskinder in den Ländern wo jüdische Gemeinden waren, im Sinne der Länder aufwachsen zu lassen. Es gibt 613 Gesetze des Judentums, Religionsgesetze. Und in diesen Religionsgesetzen steht drinnen, dass man, wenn man in einem Land lebt, wo man quasi Gast ist, dann muss man sich an die Gesetze des Landes halten. Das ist ein religiöses Gesetz. Es hat geheißen, ein ganz einfacher Satz aus diesen Gesetzen war, wir müssen dafür sorgen, dass es den Menschen in dem Land, wo wir wohnen, arbeiten und verdienen, dass es denen gut geht. Weil nur dann geht es auch uns gut. War auch nicht ganz selbstlos, aber es war ein schlauer Weg, einer der schlauen Wege. Und man hat also wirklich versucht, den Herrscher zu akzeptieren, zu respektieren, seine Steuern zu zahlen, alles zu organisieren, und im Interesse dieser Herrscher auch zu investieren. Der Napoleon hat davon auch gelebt, dass ihm die Rothschilds Milliarden geschenkt haben.-Kommen wir zurück zu Ihrer Familiengeschichte.-Das ist auch alles ein Teil meiner Familie.-Keine Frage. Wieso sind Ihre Eltern schließlich nach Bolivien gegangen?-Das war ganz einfach. Sie haben gewusst, sie müssen raus. Europa hat zunehmend keine Leute genommen, hat gesagt, wir haben keinen Platz. Es gab eine eigene, im 38er Jahr, gab es eine eigene Konferenz, ich glaube am Gardasee, in Evian jedenfalls, wo dieses Nest Evian ist. Da sind da so, glaube ich, 80 Leute aus der ganzen Welt zusammengekommen, aus der Politik, und die haben gesagt, wir müssen jetzt etwas organisieren, dass wir diese Juden unterstützen. Weil das geht nicht, dass man sie alle aus allen Ländern raushaut. Es haben ja solche Leute natürlich auch gegeben. Wir wissen das. Aber jedes Land hat sich bereit erklärt, ja, wir nehmen hier, wie viele nehmen sie? Das ist ein bisschen vom Tausender aufwärts gegangen. Das war unmöglich. Diese ganze Gruppe, wenn man bedenkt, dass laut Berechnungen des Nationalsozialismus bei der Wannsee-Konferenz geschrieben worden ist, es gibt in Europa 11 Millionen Juden, kann man nicht sagen, ja, das ist eine Kleinigkeit. Das war einfach, dem ist man ja nicht entkommen, dass man die Realitäten sich bewusst macht. Und die Länder, die großzügig waren, auch Bolivien. Bolivien war im Jahr 38, 39 das letzte Land, das noch Visa ausgestellt hat. Sonst hat man überhaupt keine mehr gekriegt. Und jedes Land hat Angst gehabt. Und die Deutschen haben in allen Ländern ihre Nazipropaganda gehabt. Nicht nur in Europa, in anderen Ländern auch. Und sie haben in allen Ländern gesagt, das sind Unmenschen. Die sind unbrauchbar. Das sind Gauner und Diebe. Die müssen wir. Und die anderen Länder haben gesagt, die hauen jetzt die Juden raus, weil das so miese Figuren sind. Und wir sollen sie aufnehmen? Das versteht man nicht. Und das ist etwas, was in gewissem Sinne auch in unserem heutigen Leben ein bisschen mitklingt. Also der Fehler, glaube ich, an diesen Dingen. Und das glauben ja, glaube ich, ja, das denke ich, das lese ich auch, schon viele Politiker oder Politikwissenschaftler, die sagen, das muss man politisch lösen, aber anders als heute. Wir müssen ein System haben, in dem wir jene unterstützen, die wirklich unter Druck stehen, um deren Leben es geht und die wir in einem gewissen Rahmen auch bei uns so versorgen können, dass sie wie normale Menschen bei uns leben können. Und diese Respektlosigkeit gegenüber anderer Art von Leben, gegenüber anderem Aussehen, anderer Sprache, anderer Haarfarbe, anderer, ja, das ist verschwunden, mehr oder weniger. Heutzutage hätten wir, glaube ich, bei einer ernsthaften, ernsthaft daran arbeitenden politischen Richtung die Chance, das in den Griff zu kriegen, Frieden zu stiften in jedem Land und nicht einfach abschieben und im Meer untergehen lassen. Das sind ja Dinge, die beschämend sind für eine Bevölkerung. Das ist etwas, was ich nie wirklich begriffen habe. Und ich habe achteinhalb Jahre gelebt als Kind unter Indios. Meine Mitschüler waren alle Indios. Das war so. Und die Sprache, der Fremde war ich dort. Aber ja, das waren keine bösen Leute.-Waren Sie integriert dort? Oder wie schnell ging es, dass Sie integriert worden sind in Bolivien?-Integriert? Ich kann nicht sagen. Ich habe, mein Bewusstsein ist erwacht. Da war ich eineinhalb, zwei Jahre oder mehr, eher mehr in Bolivien. Mein Bruder war drei Jahre. Ich weiß nicht, wie viele da schon integriert wurden. Das Integrieren ist eine Frage der Zeit und der Möglichkeiten, die irgendwo geboten werden. Und, ja, man tut sich manchmal schwer und manchmal tun sich die, die integrieren sich schwer, aber grundsätzlich hängt es immer an der Haltung der Menschen gegenüber anderen Menschen. Und das ist so einer der Inhalte auch der normalen Konfessionen, dass man sagt, alle Menschen sind gleich. Alle, ja, ist auch noch nicht so, ganz so frisch, ganz so, so eingegangen in die, bis ins Mark in Österreich und, und in anderen Gegenden. Aber grundsätzlich, ist das meiner Meinung nach der einzige Weg, den man gehen kann. Also, für mich ist das alles unbegreiflich und für mich und ich denke für jeden, der, der weiß, wie man ein Leben leben sollte und könnte und aufbauen kann, wäre eine, eine große soziale Welt die einzig mögliche Rettung.-Wie ging es Ihnen in Bolivien? Ihr Vater hat als Arzt dort gearbeitet. Ihre Mutter hat dann als Krankenschwester auch mitgeholfen.-In Bolivien war es so, dass mein Vater angestellt worden ist vom bolivianischen Militär als Arzt, weil die haben Ärzte gesucht. Die Bolivianer damals überhaupt, Ärzte, das hat es ja fast nicht gegeben. Im ganzen Dschungel, hier und da einmal irgendwo einen, nicht? Aber die, ein Gesundheitssystem ist bis heute ein Krankenschein oder eine E-Card oder so irgendeine ganze Sache. Das ist ja alles, das gibt es ja alles nicht. Aber zur Arbeit meiner Eltern, meine, mein Vater war als, als, als Garnisonsarzt in Bolivien eingesetzt. Natürlich, als Ausländer, natürlich an den Grenzen im Chaco, im Dschungel, wo kein Bolivianer hingegangen ist, freiwillig, oder? Das waren Militärärzte, aber das sind, das sind als, das waren Indios, die dort hingeschickt worden sind, nicht? Die haben mit meinem Vater zusammengearbeitet, aber durch das keiner von die, die, die, die engagierten bolivianischen Ärzte, die renommierten bolivianischen Ärzte, die sind in den Hauptstädten gesessen und haben kassiert, nicht? Also einen Krankenschein, aber das, das hat sich alles da überhaupt nicht gegeben, nicht? Weil, wenn man mit dem, mit dem Auto in Bolivien unterwegs gewesen ist und einen Unfall überhaupt gehabt hat, Bolivien ist 13 Mal so groß wie Österreich, nicht? Rettungsorganisation gibt es in dem Sinn nicht. Es gibt hier und da den einen oder anderen Flieger vom Militär oder sogar Hubschrauber. Doch Hilfe hat es nicht gegeben. Ich war mit meinen fünf Enkeln in Bolivien. Wir sind diese sogenannte Todesstraße hinuntergefahren. Ich bin nur Beifahrer gewesen im Auto, weil ich gesagt habe, mit dem Rad machen ich das nicht. Meine Kinder, die Enkel, haben gesagt, wir schaffen das. Und, und ich habe die darüber nachgedacht, was mache ich, wenn da einer stürzt und bricht sich einen Hax'n? Es ist ja da niemand. Da, da muss man wirklich nicht lange fragen, warum man dort nicht bleibt. Keine Chance in solchen Fällen. Keine Chance. Wenn man am Titicacasee Skifahren fährt, der Titicacasee, dort sind wir gewesen jetzt, mit meinen Enkeln, da waren wir in einem Boot, da sind wir zu den, zu den Inkastatuen haben wir hingeschaut, weil das ja auch sehr interessant ist, die Inkas und ihre Entwicklung. Und, äh, sind am Titicacasee gefahren und von einer Insel in die andere und, äh, auf einer Insel ist auf einmal ein Wind aufgekommen, so eine kleine Insel. Da waren, da waren Steinmauern aufgestellt, die ohne Mörtel als Bauwerke, die haben die Inkas so geschlagen, dass das passt dort und das ist nie mehr umgestürzt, aber das hat man auf diesen Inseln gesehen, wir haben uns das angeschaut, aber ist ein Wind aufgekommen, ein Sturm. Ein richtiger Sturm. Wir sind in das Boot, dann mit viel Mühe eingestiegen, weil das hat sich, das hat sich so bewegt und geschaukelt, das war ein Boot, da sind 20, 25 Leute drin gewesen, vielleicht auch 30. Das hat geschaukelt und geknarrt wie ein irgendein alte Türe, die man auf und zu macht, auf und wir sind so am Titicacasee gefahren. Der ist – ja – zweimal so groß wie das Burgenland, da waren wir am See, der ist 100 Meter tief und er ist, liegt er 4000 Meter ungefähr und er ist mehr als 12, 13 Grad plus hat das Wasser nicht und die, ja, ich hab dann begonnen drüber nachzudenken, was mach ich, wann da jetzt mit dem Boot was ist, weil in einem 12, 13 Grad Wasser kann man vielleicht sogar ein paar Stunden überstehen, aber in ein paar Stunden kommt dort nirgendwo eine Hilfe, gibt's ja nicht. Also, ich hab mich gefürcht, also, ich habe, ich bin ausgestiegen aus diesem schlingenden Boot und, und, und, und habe so einmal ausnahmsweise ein Stoßgebet zu allen Göttern und Teufeln dieser Welt geschickt, weil das ist ja unglaublich, das sind ja selbst gebastelte Boote von den Indios und du hast nie gewusst, die zerbreselt's manchmal, ist halt so, das ist, also, das dort zu leben und, und in diesem Land zu leben, wo, wo unsere europäische Kultur nicht bekannt ist, interessanterweise, die Indios im Dschungel haben gewusst, dass es einen, wie sie das genannt haben, Juan Estraus gibt. Juan Estraus, mein Vater hat am Anfang, das hat er auch beschrieben in seinem, hat er gesagt, am Anfang haben wir nicht gewusst, was wollen, was ist das? Juan heißt Johann, Estraus heißt deswegen Estraus, weil, weil ein S und ein T stehen, Konsonant, hintereinander, dann spricht man das eben so aus, man sagt dann Estraus, nicht Strauss. Da, da haben wir gewusst, es gibt Vienna, es gibt Wiener Walzer, Vienna Walzer, haben meinen Vater gefragt, ob er da den ganzen Tag tanzt, normalerweise in Österreich, die, die haben nichts von all dem gewusst, aber Wien und Wiener Walzer und Wiener Schnitzel und Sachertorte, das sind so Sachen, ein bisschen, die es vielleicht eher jetzt noch merken, meine, meine Mutter hat dort Sachertorten gemacht, im großen, im Dschungel, in einem, in einem Ofen aus Lehm und hat da die Bevölkerung ein bisschen damit versorgt, die waren ganz begeistert, so, die alle, Biskuitrouladen, so, wie eine Schnitzel, wir haben so, meine Mutter hat die Chance gehabt, so, manchmal so, Fleisch zu kriegen, wo man auch Schnitzel machen kann, und wir haben manchmal Besuche gehabt von europäischen, von, von Geistlichen, die, die ihre, äh, äh, äh, Schäfchen besucht haben und von anderen Menschen und von Leuten, die nach dem Krieg gekommen sind, nach dem Krieg, war ein bisschen suspekt, aber die sind aus, aus Graz oder aus Innsbruck und, und die sind dann zu uns gekommen, in den Dschungel und meine, wenn jemand Deutsch gesprochen hat und gekommen ist zu uns, hat meine Mutter gesagt, versucht, irgendwo eine Schnitzel zuwegezubringen, nicht, sie hat wie eine Schnitzel, da hat es einen gegeben, der hat so immer, von Zeit zu Zeit gefragt, wie es ausschaut, er hätte gerne einmal vorbeikommen, so, also, das ist ja so etwas, was, also für uns Kinder war das schon nichts, gar nichts, wir haben, wir haben nicht gewusst, was man alles, was es alles nicht gibt, wir haben, wenn, wenn mich wer gefragt hat, bei unserem Verlassen von Bolivien. Wo ich hinfahre. Ob ich dorthin fahre, wo die Kängurus sind und da habe ich gesagt, nein, das ist, das ist Australia, Austria ist Europa, was haben sie gesagt, wo ist Europa, habe ich gesagt, es heißt so, Europa, dort ist Vienna und, und das ist Austria und, und ich habe keine Ahnung gehabt von der Geografie. Das war kein Land, in dem meine Eltern sich vorstellen konnten, die Kinder großzuziehen und uns, wir waren dann da vier Personen, meine zwei Schwestern, die in Bolivien geboren sind, wir waren dann sechs Personen, als ein Ganzes, als Familie, dann darüber nachzudenken, ob wir nicht nach USA gehen sollen, wo mein Vater eh angespeist war, weil er, damals, wie er in die USA wollte, im 38er Jahr, 39er Jahr, haben sie ihm, haben sie ihn nicht genommen, die haben sich, ja, der hat dann gesagt, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, und, und, und außerdem, in Österreich, war die Mutter meiner Mutter und die Schwester meiner Mutter und, und, und meine, die Geschichte meines Vaters, die ganze Familie, die in Wien gewohnt, die haben da, wo das Diana-Bad einmal war, in Wien, da haben sie also das, eines ihrer Geschäfte gehabt und da, in der Nähe ganz, in der Nähe war die Getreidebörse, da hat einer der Onkel meines Vaters gearbeitet, die waren also dort daheim, das waren so, Wirtschaftler da, die waren also integriert in der Gesellschaft, das war. Das, das ist also etwas, was, deswegen kann ich mit der Religion auch nicht so, so viel anfangen, das darf man gar nicht laut sagen, aber, ich, ich, für mich ist die Schicksalsgemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin, wirklich entscheidend gewesen, und ist es, überhaupt keine Frage, weil, meine ganze Familie, die da, einmal gelebt hat, in Wien, und, sich, verstreut hat, in der ganzen Welt, der Bruder meines Vaters, der ohne, ohne Papiere aus Österreich aus ist, da haben sie ihn gefangen, dort war er in Brüssel, in einem Auffanglager, dort hat er, eine Berliner Jüdin kennengelernt, ja, die kamen aus Berlin, auch in das Auffanglager, und, mit, und die hat er ihm gesagt, ja, sie hat Verwandte in Rio de Janeiro, und du fährst jetzt hin, weil, da hat es, da hat es eine Möglichkeit, die hat er mitgenommen, und er hat gesagt, ja, und die sind, die sind dann zusammengezogen, und geheiratet, und, der ist nie wieder nach Österreich, also, zu Besuch schon, aber, der ist in Brasilien, in Rio de Janeiro gestorben, der hat natürlich einen Job gehabt, das ist ihm gut gegangen, aber. Ja, die anderen, die immer wieder zu Besuch kamen, aus Tasmanien sogar einer, und, natürlich aus Australien ein paar, und aus, aus Shanghai ein paar, und, und aus Amerika, aus USA, da war da so diese, diese Verwandtschaft meines Vaters, der, der Hans Popper, der sogar mit meinem Vater studiert hat, der Cousin, der nähere, der nähere Cousin zu meinem Vater, als, als der Sir Karl, und, der hat, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, im Jahr, 47, 57, zehn Jahre nach dem Krieg, da war er im Studium schon, 57, hat er erzählt meinem Vater, ja, er hat den Sir Karl eh getroffen, vor kurzem, die haben sich getroffen, irgendwo in New York, weil der hat dort irgendwas zu tun gehabt, und, die, die waren noch in Kontakt, und, aber der, dieser, dieser Hans Popper, hat aber damals auch gesagt, nach Österreich, nach Wien, nie wieder, der hat seine Karriere gemacht, der war, Chef der Pathologie im Mount Sinai Hospital, in New York, der war, der hat eine, eine, äh, Mount Sinai School of Medicine gegründet, der Hans Popper, und hat unterrichtet in der Columbia University, und war dort zum Schluss einer von den Dekanen, dem ist gut gegangen, der hat also, Österreich ist vorbei, ne, das ist vorbei, also da sind viele gewesen, die gesagt haben, das kommt nicht mehr in Frage, und dann gab es viele, die gesagt haben, ohne Österreich kann ich nicht leben, alles hat es gegeben.-Und der Unterschied zu Ihrer Familie war wahrscheinlich, dass in Bolivien die Dekanen Chancen geben, heran?-Jede Chance. Jede Chance. Wir waren ja Ausländer, bis zum Schluss, wir waren ja nicht Staatsbürger, mein Vater war, ähm, äh, Ausländer, und ist dort, und hat von Anfang an gesagt, da kann ich nicht bleiben, weil, da haben meine Kinder keine Chance in der Zukunft, was sollen die da hier? Und er hat, damit hat er recht gehabt, weil es ist bis jetzt, sehr problematisch. Ich habe so einen, äh, einen Deutschen kennengelernt, der geboren ist, 1943 schon, in, in Bolivien, der dann, äh, mit Unterstützung der deutschen Regierungen, ein Stipendium bekommen hat, für das Studium der Politologie in Berlin, und der später, von dieser Organisation auch, in verschiedene Städte, er war dann in, in Mexiko City, er war in Buenos Aires, und natürlich, in La Paz, an der Universität gearbeitet hat, nicht? Ja, aber, der, wenn ich jetzt, in den letzten Jahren, wo ich noch in Kontakt hatte mit ihm geredet, hat er gesagt, er hätte gehen, er hätte müssen gleich heim, das ist, man hat keine Chance, keine gescheite Pension, der kann nicht nach Österreich fliegen, dass er sich da einen Freund trifft, oder was, es geht über, die haben nichts, nichts, und das ist ja, ja, braucht man das, ist die andere Frage, nicht? Wir haben als Kinder nichts braucht, ja? So war das. -1947 sind Ihre Eltern, mit vier Kindern, nicht mehr zwei, sondern vier Kindern, zurückgegangen in Wien. Ja. Sie haben schon geschildert, welche Motive dahinter standen. Ja. Wie ging es den Eltern, und auch Ihnen, die ja in Bolivien aufgewachsen sind, also vor allem Ihr Bruder und Sie, Sie waren neun Jahre alt, wie Sie zurückgekommen sind, wie ging es Ihnen dann in Wien, in einer zerbombten Stadt?-Für uns besonders für meinen Bruder und für mich, also da ist noch ein Unterschied, eben, weil meine beiden Schwestern, die in Bolivien zur Welt gekommen sind, die ältere von ihnen war im Jahr 47, wie wir gekommen sind, war sie sechs Jahre alt. Ja, war nicht, die Jüngere, die war erst zweieinhalb Jahre alt, die hat überhaupt, das war für die, so wie für mich, beim Runterfahren nach Bolivien war Europa nichts, hat es nicht gegeben, so gibt es für sie, es ist ein Land, ein Kontinent, ja, mehr hat sie nicht, Beziehung, wir, die Älteren, wir haben, wie wir nach Österreich gekommen sind, und das muss ich sagen zuerst einmal, das war im Dezember des Jahres 47, da haben wir so gefroren, dass wir gesagt haben sofort, wir schauen, dass wir irgendeinen Beruf lernen und fahren heim nach Bolivien. Das war für uns, es hätte ja wirklich kein Outdoor-Equipment gegeben, wie es heute, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wir halten zu einer normalen Hose so lange weiße Strümpfe mit Strumpfhaltern anziehen, wir Buben, also zur Not, ja, das war wärmer, also wir haben, unsere Mutter hat uns solche Hosen zusammengenäht und so, und das ist, und die Schuhe, die Schuhe waren, das war eine besondere Form von Pappendeckel, das war das sogenannte Leder und das andere war eine Holzsohle und wir sind mit dem gegangen und im Winter noch keine warmen Socken, gar nichts und für uns war das eine Katastrophe, uns haben die Füße weh da, die erste Zeit, weil wir haben Blasen gekriegt an alle Ecken und Enden, das waren wir nicht einmal gewöhnt, ja, und grundsätzlich war uns die Kälte eher schon ein bisschen zuwider, also es war nicht so, dass wir, dass wir da das Gefühl hatten, jetzt sind wir wieder daheim, wir waren weg von zu Hause, wir haben, das einzige, wo es einmal angenehm war, war in Bolivien das letzte Jahr in La Paz, liegt fast 4000 Meter hoch und das Klima geht, das heißt, ob Sommer ist, Winter ist, ist wurst, weil der Temperaturunterschied war nicht so groß und Schnee sieht man von den Bergen, die irgendwo weiter weg sind, das ist weiß, mehr haben wir nicht gewusst, was Schnee ist, haben wir nicht gewusst, was eine Rodel ist, haben wir nicht gewusst, was Ski sind, das hat es ja fast vielleicht in Österreich in manchen Familien gegeben, weiß ich nicht, aber wir waren ahnungslos, wir haben also, und wir haben gemeint, wir gehen zurück und ersparen uns dieses ganze, das neue, das Essen, mit diesem, mit diesem Geruch, das war ein bisschen anders als das, was wir gewohnt waren, weil wir, wir haben also sehr viel Mais und solche Sachen unten gegessen, verschiedene Gerichte aus Mais und Empanadas haben wir gegessen und, und, und, verschiedene andere Sachen.-Orangen, glaube ich, waren dabei, Südfrüchte, die man in Wien nicht gekannt hat.-Also das schon gar nicht, das habe ich in der Schule auch alle mal erzählt, wir haben, wenn man Fußball gespielt hat, wir haben ja keine Bälle gehabt, als Kinder, im Dschungel, das hat es ja nicht gegeben, ein Gummiball, also meine Mutter hat manchmal aus ein paar Fetzen ein Ball gemacht, aber nach einem Match, spätestens nach dem 2. oder 3. ist das zerfleddert gewesen, war hin. Und dann sind wir, wann's Zeit warm und dann ja, zu einem von diesen Bäumen, haben auch nicht von den großen Orangen abgenommen, haben mit der Orange weiter gespielt, wir haben mit der Orange Fußball gespielt, die haben die, unsere Schulkollegen haben nicht gewusst, was, ja, sie haben schon Bilder davon gesehen, aber, wie das schmeckt, oder was das ist, Bananen, die haben keine Ahnung gehabt, was Bananen, wie es ausschaut, da haben sie gezeichnet gesehen, Zeichnungen gesehen, aber, wir haben dort verschiedenes, Südfrüchte, wir haben ein Essen gehabt, das in sehr vielen Fällen aus, aus, über Kohle gebratenem Fleisch bestanden hat und, und, und Mais in verschiedensten Fassionen, da gab es Mais und Asado, das gebratene Fleisch war so als Hauptspeise und, und Geflügel hat es nur da gegeben, da hat es so alles Mögliche gegeben und, da haben wir, ja, und wir hatten damals dort eigentlich im, im Nahbereich, also am Haus, so eine Art kleine Landwirtschaft mit Enten und Gänsen und mit, mit, äh, natürlich Hühnern, natürlich, äh, anderen Viechern, äh, wir hatten also keine größeren Viecher, aber die Schweinchen haben wir von den Bauern irgendwo bezogen und so, also, das war schon möglich, da zu überleben und, es ist uns nichts abgegangen, weil, irgendwelche Besonderheiten, also, Dessert, Honig hat es gegeben und, und, aus, äh Zucker, also, Zuckerrohr gemacht, äh, eine, eine Süßspeise, das ist ein, ein Brocken, ein brauner Brocken, das schaut aus wie so ein Karamell ähnlich und so weiter, das war eh nur Frucht, das war nur Zucker, der Zucker, der Zuckerstauden, also, und das haben wir, das haben wir gegessen, geschluckt, ja, das war, ja, man weiß, hat, ja, also zum Geburtstag von uns Kindern hat's immer eine Torte gegeben, das hat meine Mutter gemacht und, das war schon was Besonderes und, sonst haben wir, haben wir, dort, eigentlich, wir waren auch nicht verwöhnt mit irgendetwas, wir haben, dort, einige Weihnachtsfeiern erlebt, in Bolivien, mein Vater hat, aus so einem Stock von einem Besen zusammengebastelten Christbaum gehabt, der hat also so, äh, zusammengeschnittene Papiernadeln sozusagen gehabt und die waren auf einem Draht, das, äh, die Äste waren Draht, man hat das können zusammenlegen und eine in den Kasten und das nächste Mal hat man es wieder aufgebogen bei den nächsten Weihnachten und hat also dort Weihnachten gespielt, wir haben nicht gewusst, was das ist, Weihnachten, das gibt es ja dort nicht, also es gibt schon, aber Geschenke und diese ganzen Sachen und in Gran Chaco war das so, da haben wir eigene, sogar mein Vater von irgendwelchen, seiner Reisen im Namen des Militärs manchmal so kleine Kerzen mitgebracht, da hat er dann, äh, so eine, äh, eine Klemme gehabt, wo man das fixieren konnte und er hat einen Baum gestellt und dann, wo ist, ist das angezündet worden, diese, dieser Baum und das war so, dass wir Kinder da nicht zuschauen durften und, dann hat irgendeine Glocke geläutet und dann sind wir in das Zimmer hineingegangen, da haben, auf diesem Stock mit diesen ausgefransten Asteln hat, haben ein paar Kerzen gebrannt und, dann hat es geheißen, geschwind, geschwind, kommt's, was braucht ihr so lange, weil während der, mein Vater das angezündet hat und geläutet hat, diese Kerzen haben angefangen sich zu verändern, es hat 45, 44, 45 Grad gehabt im Schatten, das war Sommer, Dezember war in Bolivien Sommer und die höchste Temperatur, die mein Vater, er selber Messmöglichkeiten gehabt hat mit Thermometern und so, 49 Grad war die höchste Temperatur, die wir erlebt haben in, im südlichen Bolivien in Gran Chaco, in La Paz waren es 20, war schon ein bisschen kühl, nicht, aber, ja, das war im Winter. War wirklich kein Problem, weil, wir hatten im Winter dort hatten schon einen Mantel an oder so, das hat's nicht gegeben, hat man auch nicht gebraucht, das war, für, also für uns war die, das Österreich eine Offenbarung insofern als wir vieles kennengelernt haben, von dem wir überhaupt keine Ahnung gehabt haben, den Krampus, also, an das erinnere ich mich sehr gut, wir sind so Anfang Dezember gekommen und am nächsten Tag kommt da einer an die Tür in der, in der, in der Herbststraße im dritten Stock auf einmal klopft's und raschelt's und so weiter und, die Mutter geht hin, macht die Tür auf, also, stürzt einer rein mit Maske und, und Rute und kommt zu uns Kindern und, und fängt an auf uns her zu prügeln und, mein Vater hat sich so kurz dazwischen geschmissen, da, äh, die Schwester meiner Mutter war verheiratet mit einem Eisenbahner, der dann, übrigens, ein Arbeiter, der während des Krieges ein gestörter, äh, sturer Nazi gewesen ist und, na, der hat uns dann empfangen, wie wir wieder nach Österreich gekommen sind und der hat uns wollen eine Freude machen, Krampus, also, mein Bruder und ich, wir, da hat uns unsere Mutter dann erklärt, dass das nicht so ernst ist und, das war Horror, ja, das war, ja.-Kann ich mir Oh Oh mein Gott. -Das waren die Dinge und in der Schule war das Problem natürlich das, dass wir die Sprache nicht wirklich beherrscht haben, wir haben sehr bald gelernt uns mit, äh, den Worten zurechtzufinden, aber, die Schüler haben uns oft Worte gelehrt, beigebracht und haben uns dazu eine Bedeutung gesagt und manchmal sind wir da nach Hause gegangen damit und haben das gesagt und meine Mutter hat dann einen roten Schädel gekriegt, das waren ordinäre Sachen, das haben wir, also, am Anfang nicht überrissen, aber wie, ich bin ja in der, im 16. Bezirk in die Volksschule gegangen, in der Koppstraße, das war nicht weit von der Herbtstraße, äh, eine Parallelgasse und, äh, da haben wir, also, ähm, ja. Haben wir, also, am Anfang, äh uns noch gegenseitig auch ein bisschen erschreckt, aber, dann haben wir festgestellt, wir, wenn wir ein neues Wort hören, müssen wir drüber reden, was es wirklich bedeutet, bevor wir es sagen, net, also, wir haben uns ja Schimpfworte beigebracht und die Bedingungen des Lebens, net, man ist, ja, man ist ja überall auch hingekommen, wir sind ja, wir haben ja Urlaube gemacht, auch in Bolivien, mit den Eltern, hier in Österreich und da, da sind wir halt mit, mit dem Zug irgendwo hingefahren und waren da zwei, drei Wochen, das war damals in den 40ern und 50ern war das so, zwei Wochen Urlaub, da hat's, einmal, äh, ja, was, zwei Wochen Urlaub hat geheißen, na ja, sieben, acht Tage einmal regnet's, nicht, und, es hat damals viel geregnet, und wir waren verzweifelt, weil in Bolivien hat es zur Regenzeit geregnet, da sind alle Flüsse übergegangen, alle, die trockenen Flussläufe, waren auf einmal gefüllt, das war also ganz spannend zu schauen, was da runter kommt und, ja, wir haben hier in Österreich ein anderes Wetter kennengelernt, jedenfalls ein anderes Essen kennengelernt, diese, diese, diese. Äh. Wie heißt die, gebrannte Hunde, diese Kartoffeln, dieser, ein bisschen saure Kartoffelschmarren, der, der mit einem Einbrennen gemacht war, so. Hat scheußlich geschmeckt, nicht. Scheußlich, wir haben sowas in Bolivien nie gegessen, das ist, jetzt esse ich auch lieber Pommes frites, also, na gut, also, es hat sich vieles für uns geändert, und.-Es ist, auf der anderen Seite ist aber die Intention der Eltern tatsächlich aufgegangen, also, die Kinder haben einen Beruf gelernt, eine Karriere gemacht, als Arzt im Burgenland,..-Ich war ja mit den Kindern in Bolivien, also, das war eine Hetz für die, aber dort wieder runter.-Ja, wäre ein völlig anderes Leben gewesen.-Ja, das wäre für europäische Begriffe kein Leben gewesen, und, wenn man, wenn man sich das überlegt, und, und nicht so viel als andere kennt, kann man natürlich auch sich überlegen, für uns Kinder war das schon schön, wir haben ja, in der Schule, wir haben ja, ich bin dort viereinhalb Jahre in die Schule gegangen, mit fünf habe ich angefangen, wir haben ja nie einen Lehrer gehabt, eine Lehrerin, sondern einen Aufpasser, also, das waren meistens, waren das, das waren Freundinnen vom Bürgermeister, oder von irgendeinem, von diesen Beamten, oder von einem Chef, vom Militär, die haben diesen Job gekriegt, nicht, weil das, die mussten nichts anderes können, als lesen und schreiben, und das kleine Einmaleins, das hat, das haben wir unterrichtet bekommen, mehr gab's nicht, und, das hat bald wer zusammengebracht, aber, das war, wie wir unten waren, kann man sagen, also, 75 Prozent waren Analphabeten, die haben erzählen können, alles mögliche, Geschichten, Raubersgeschichten, haben wir genug gehört, sind zum Teil sogar in diesem Buch einige drinnen, wie uns die erzählt haben, was für, was für Viecher es im Wald alles gibt, und so, und, ja, das ist, das war für uns, für uns ein Erlebnis, das war für uns, in den Schulen hat uns, hat uns, haben uns die Mitschüler öfter zu verstehen gegeben, meinem Bruder und mir, euch ist ja eh gut gegangen, ihr habt's immer alles gehabt, und wir Armen, haben müssen in Österreich bleiben und den Krieg erleben, und die Lehrer haben sowas ähnliches auch gesagt, und das haben Lehrer, die gesagt haben, also, diese Leute, die da zurückkommen, zuerst haben sie sich geschlichen, wie Krieg war, und jetzt kommen sie wieder, so ist das interpretiert worden, also, uns gegenüber auch, selbst in der Schule, wo mein Bruder und ich noch manchmal wirklich, wir haben schlechtes Gewissen gehabt, weil wir unseren Mitschülern erzählt haben, wie schön das war, in Bolivien, und da war kein Schuss, da war kein nix, und die haben den Krieg gehabt, ja, und das ist etwas, was uns, ja, dass man nicht wirklich genug schätzen kann, dass wir eine Kindheit erlebt hatten, ja, das war, also, das war vorbei, und deswegen, mein Bruder, bei dem war das, er war älter als ich, bei dem war das noch viel länger, das hat lange angehalten, der hat gesagt, das hält er nicht aus in Österreich, er will das, er will weg, und hat das dann so auch eine Zeit lang, ja, Reisen gemacht, auch nach Bolivien, nach Südamerika zumindest, mehr weiß ich nicht, wir haben keinen Kontakt, also, wir Geschwister, ich habe ja bis zu meinem 16. Lebensjahr, da war er schon 18, aber, wir haben ja quasi ein Leben lang im selben Zimmer geschlafen.-Aber, da sieht man, wie sehr das Menschen prägt, wenn sie neu anfangen müssen.-Ja, aber er war immer schon, er war als Kind auch schon ein Einzelgänger. Ja, also, von Kindheit an, also, meine Mutter hat das erzählt, da war er in dem Park, in dem man ja normalerweise nicht hat dürfen, aber es gab ein paar so Beserlparks in Wien, da hat, das waren so dreckige Dinger, da haben die Juden auch hinein dürfen und da sind wir spielen gegangen mit dem Opa und der hat uns dort hingeführt und hat aufpasst oder so, oder weniger, weiß ich nicht, aber jedenfalls, die Mutter hat uns manchmal dann geholt vom Spielplatz und dann hat sie meinem Vater in die Schweiz in den Brief geschrieben, also, was mir so Sorgen macht ist, der Peter, mein Bruder, der sitzt immer irgendwo allein und spielt sich mit sich allein und der Lutz ist immer mitten drinnen im ärgsten Dreck und der ist bei allen dabei, das war wirklich ein Unterschied, das hat sie in den Briefen artikuliert.-Sie haben die Aufzeichnungen Ihrer Eltern in zwei Bücher verfasst, Bolivien für Gringos, das 2004 oder 2005 erschienen ist, 2005, und Briefe aus einer versinkenden Welt, 1938, 1939, wo Sie die Briefe, den Briefkontakt Ihrer Eltern in einem Buch...-In einem die Vertreibung, also, die Vertreibung aus Österreich ist mir später erst als Ereignis bewusst geworden, da habe ich die Briefe, die mein Vater, das, was mein Vater in Bolivien geschrieben hat, das habe ich, das war Maschinen-geschrieben, nicht, und, nein, es war handgeschrieben, meine Schwester hat es schon einmal in die Maschine geklopft, aber ich habe dann diese Handschrift, wie mein Vater gestorben ist, wie die ganzen Sachen in der Erbschaft übernommen, weil es hat keiner haben wollen, und ich habe also das dann in den Computer hineindiktiert und habe da, also, diese Texte und habe daraus dieses Buch gemacht. Es lesen, dort wo ich sie hergegeben habe, vorwiegend die Frauen. Weil das, das, was meine, wie es meiner Mutter gegangen ist, ist für viele Frauen nachvollziehbarer, also, dass sie da allein war, dann in Wien und so weiter und nachher, und alles, sie hat ja in Wien dann alles für die Ausreise in unbekannte Regionen und dann auch Bolivien hat sie ja da organisieren müssen, beim Wanderungsamt und bei den Passämtern und überall, ist heute und hat da so geschaut, dass die, mein Vater hat da geschrieben und da haben, ja, bitte da habe ich wissenschaftliche Arbeiten deponiert, auch im Dekanat, bitte hol das alles, was mir gehören könnte, das brauche ich vielleicht einmal und so weiter, sie hat das alles zusammengesammelt, ja, also das Dekanat hat ihm dann zum Schluss angeschrieben, sogar meinen Vater, wo drin steht, nachdem sie, nachdem sie quasi ein Jud sind, werden sie nicht Dozent werden, aber sie können sich die Papiere im Dekanat holen, das war 38, im Juni 38 und das hat er so natürlich geholt, nicht er, meine Mutter, die ist also dann hin und hat also das alles zusammengesammelt, er war am Anfang bis, bis August 38 war mein Vater noch in Wien, hat also auch ein bisschen was da getan und diese Unterlagen, die haben wir halt noch, das ist ganz praktisch, wenn Befunde, wenn also Briefe und, und solche Sachen da sind als, als Dokument und das, das ist alles im Dokumentationszentrum des österreichischen Widerstandes, alles, die originalen Briefe, Befunde habe ich alle, ich sie zusammengesammelt, der hat also im Archiv des Dokumentationszentrums ist ein Archiv Popper und da sind die Sachen, die ganzen, die Zeugnisse auf Spanisch, die meine Mutter bekommen hat, mein Vater bekommen hat, das ist alles da drinnen, das Original jeweils, das andere habe ich im Computer, die Bilder, die ich herzeige den Kindern in den Schulen, das habe ich ja im Computer, aber ich habe die alle, was original ist, an einer Stelle zusammen gesammelt und habe gesagt, für den Fall, dass es Studenten gibt, die da irgendwas suchen, kann ja nicht schaden, und es ist dort, ich weiß nicht, ob es genutzt wird, oder jedenfalls.-So interessant und aufregend diese Familiengeschichte ist und ihr Leben war, führen Sie – eine letzte Frage– führen Sie selbst Tagebuch?-Ich führe kein Tagebuch, nein, das hat mein Vater interessanterweise schon als Junge gemacht, mein Vater hat, wie er 14 Jahre war und in der Schweiz gelebt hat damals, hat dort maturiert in der Schweiz, in Zürich, und Ausflüge gemacht hat, auf eine Wanderung gegangen oder mit der Schule, hat ein Tagebuch geführt und hat sogar seine Lehrer gezeichnet, es gibt ein paar so Karikaturen von seinen Lehrern und so und Gedichte von, von, über, naja, ein paar so Gedichte eines 14-Jährigen über die große Liebe und solche Sachen, also, das habe ich, das ist auch ein Dokument dazu, alles gesammelt im Dokumentationszentrum, jeder kann sich das Original da reinschauen, man kann also dorthin gehen und in den Briefen meiner Eltern blättern, die sind ja zum Teil so dünn, dass das fünf Blattl sind, was so ein Blattl ist, also Flugpapier, das hat ja für Flugpostbriefe eigenes Papier gegeben, weil das so leicht ist, ja, und da ist es manchmal ein bisschen vergilbt, und die Schrift meiner Mutter zu lesen. Ich konnte alles lesen, weil ich ihre Schrift kannte, aber es ist kurrent, wer sich nicht auskennt, der kann das nicht so ganz, wobei von Dokumenten habe ich mir kurrent auch übersetzen lassen zum Teil von Leuten, die das kennen, weil das war eine andere Schrift, die sie vor 100 Jahren noch gelernt haben.-Lieber Herr Popper, so viele Geschichten es noch gebe oder so viele Anekdoten und Aspekte, vielen Dank für das Gespräch.-Ich danke, dass ich ein bisschen die Möglichkeit habe, zu erzählen, was ich natürlich als Zeitzeuge sowieso immer wieder nutze, aber da sind die Themen ein bisschen vielleicht anders, grundsätzlich aber erzähle ich natürlich, diskutiere ich die Schulgeschichte genauer, ich bin nur in den Schule gegangen, und habe niemals, ich habe einmal in meinem Leben ein Zeugnis bekommen, das war im letzten Jahr, 47, in La Paz, dieses Zeugnis liegt da übrigens auch im DÖW, wo es von den anderen Schulaufenthalten gab, hatte ich nie ein Zeugnis, das war, mein Vater hat gewusst, mein Mutter, da war ich dort, aber, ob ich was ich zu der Note gekriegt habe, wir haben nichts gelernt, ich meine gelernt im Sinne von Strebern, das habe ich nicht gekannt, das hat es nicht gegeben.-Vielen Dank für den wirklich sehr beeindruckenden Einblick in einen Teil Ihres Lebens.-Ich danke, dass wir das so machen dürfen, und dass es noch so angekommen ist, dass man versteht, was ich meine.-Zu Gast bei Barbara Kedl-Hecher war Zeitzeuge Lutz Elija Popper.