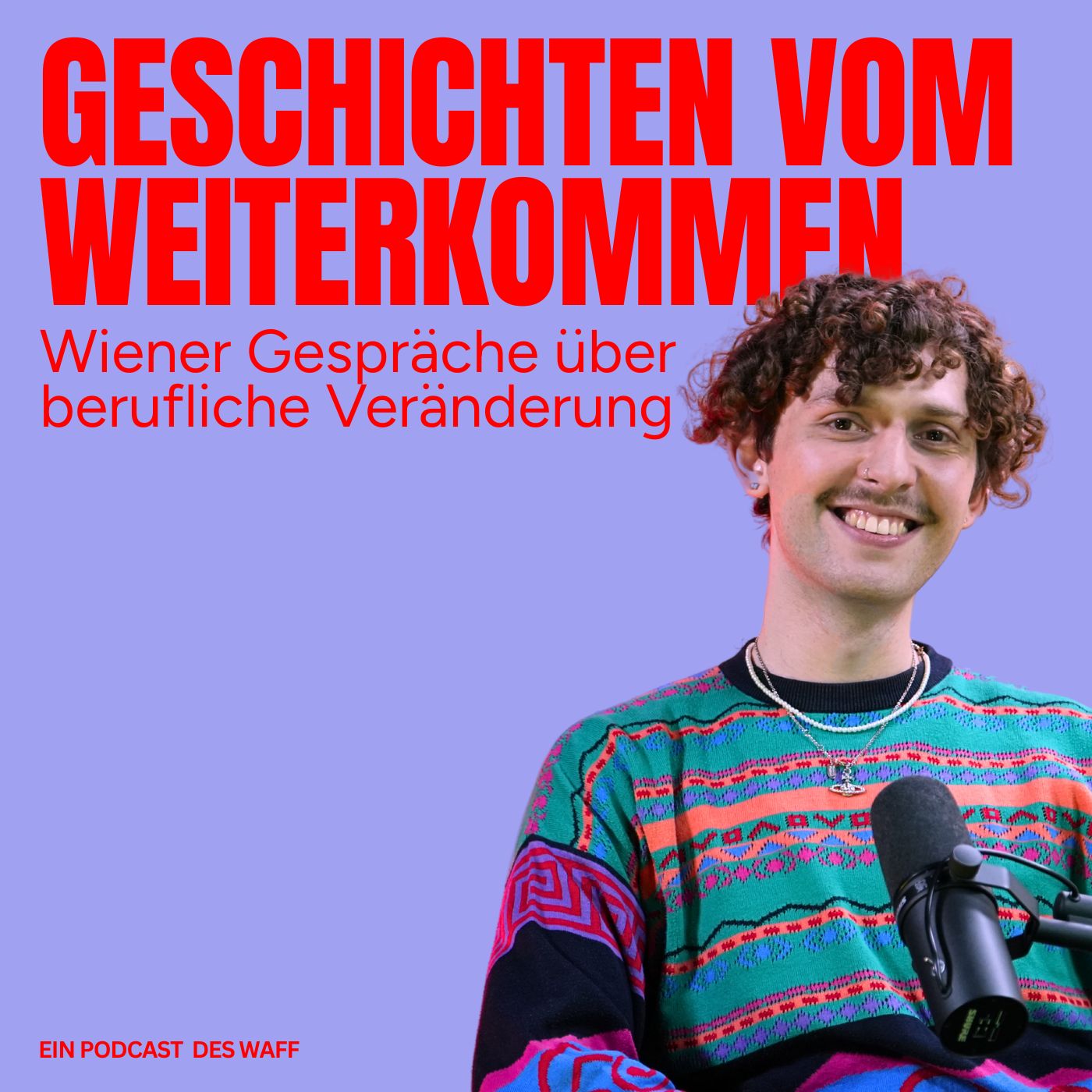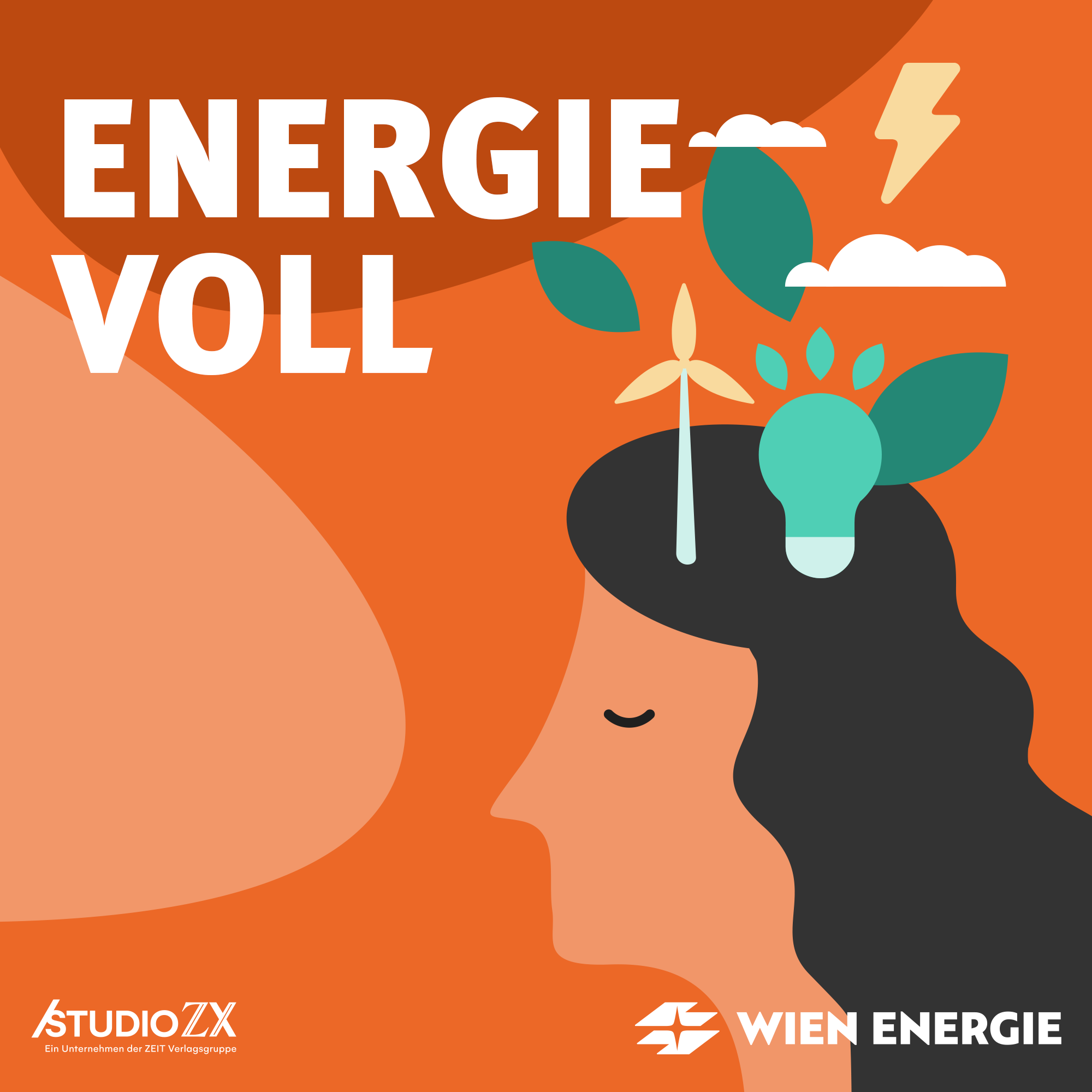Stadt Wien Podcast
Stadt Wien Podcast
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling: „Ich brenne darauf, in dieser Stadt viel umzusetzen“
In dieser Folge des Stadt Wien Podcasts spricht Gastgeberin Christine Oberdorfer mit Wiens neuer Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling über aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich: Was kann ein Handyverbot an Schulen bewirken? Wie soll Sprachförderung verbessert werden? Und wo hat Schule die Möglichkeit zur mentalen Gesundheit von Schüler*innen beizutragen?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert (falls ihr das noch nicht gemacht habt).
Feedback könnt ihr uns auch an podcast(at)ma53.wien.gv.at schicken.
Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen:
https://www.facebook.com/wien.at
https://bsky.app/profile/wien.gv.at
https://twitter.com/Stadt_Wien
https://www.linkedin.com/company/city-of-vienna/
https://www.instagram.com/stadtwien/
Und abonniert unseren täglichen Newsletter:
http://wien.gv.at/meinwienheute
Weitere Stadt Wien Podcasts:
- Historisches aus den Wiener Bezirken in den Grätzlgeschichten
- büchereicast der Stadt Wien Büchereien
-Herzlich Willkommen zu einem neuen Stadt Wien Podcast. Heute zu Gast bei Christine Oberdorfer, Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.-Wir sprechen über ihre Visionen für die Stadt, Herausforderungen im Bildungsbereich und wie sie zum Handyverbot in den Schulen steht. Danke fürs Kommen.-Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und guten Tag.-Zuerst mal herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt Vizebürgermeisterin in Wien. Wie fühlt sich das denn an? Wie hat sich denn Ihr Leben in den vergangenen Tagen verändert?-Rasant verändert, würde ich wirklich sagen. Es ist wirklich alles sehr schnell gegangen. Ich bin erst vor einer Woche angelobt worden und mir kommt diese eine Woche vor. Es wäre ein Monat vergangen, weil so viele Termine anstehen und ein neues Amt erfordert natürlich die volle Aufmerksamkeit. Und deswegen muss ich mich in vieles erst einleben, eingewöhnen, mit vielem erst zurechtkommen. Aber ich glaube, ich bin gut dabei. Und natürlich sind auch die Interviewanfragen zuhauf da, die ich aber auch sehr gerne annehme. Und es macht mir auch Freude und Spaß, über das zu erzählen, warum ich in die Politik gegangen bin, wofür ich brenne und was ich hier auch wirklich in dieser Stadt erreichen und umsetzen will.-Wollen Sie uns mal erzählen, warum Sie in die Politik gegangen sind? Was sind denn Ihre Visionen für die Stadt, für eine Großstadt wie Wien?-Dieser Weg in die Politik war bei mir ein relativ langer, bis ich dann wirklich angekommen bin. Ich habe immer einen Gestaltungswillen gespürt, indem ich einfach sehe, was passt in der Umgebung nicht, was könnte man ändern, wie könnte man etwas besser machen. Ich bin dann durch meinen Beruf bei der österreichischen Energieagentur, ich war dort Projektleiterin und wir haben viele wissenschaftliche Studien gemacht und immer auch der Politik vorgelegt, also den Ministerien oder den Ländern oder eben Energieversorgern. Und dieser Gestaltungsdrang hat sich da entwickelt, weil ich gemerkt habe, Politik reagiert oft opportun und nicht nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen oder was jetzt auch wirklich gebraucht ist. Und dann war es aber schlussendlich auch wirklich Matthias Strolz, der mich inspiriert hat, mit seinem Flügelheben wirklich anzukommen in der Politik und mitzumachen und nicht nur sich überlegen, was wäre, wie könnte man, sondern auch wirklich dabei zu sein. Und meine Kinder waren damals noch sehr klein und die beste Bildung, die besten Startchancen fürs Leben, das ist etwas, was mich antreibt, aber was mich dann auch wirklich bewogen hat, in die Politik zu kommen.-Das heißt, Sie kommen ein bisschen aus dem Umweltbereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt ist ja Schwerpunkt die Bildung. Was sind denn da die Visionen? Wien hat ja gerade im Bildungsbereich große, große Herausforderungen.-Ja, meine Vision ist, dass jedes Kind sich nach seinen Möglichkeiten entfalten kann, dass es seine Stärken entdeckt, dass es in einem Umfeld aufwächst und gefördert wird, auch in Kindergarten und Schule, dass es auf diesen Weg kommt, dass auch Eltern das Vertrauen haben in unsere Bildungseinrichtungen, dass sie sagen können, jede Schule ums Eck, egal wo wir wohnen, ich habe das Vertrauen, das ist die beste Schule für mein Kind. Weil das erfahren wir oft und wissen von Berichten, dass Eltern sich viele Gedanken natürlich machen, wo ist die bessere Schule, wo könnte ich mein Kind hinschicken, wo hat es die besten Chancen. Und diese Verantwortung und Frage ist meine Vision, den Eltern abzunehmen, weil sie sich sicher sein können, jede Schule in Wien ist die beste Schule für ihr Kind.-Wie ging es Ihnen da mit Ihren Kindern?-Ähnlich, ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, aber schlussendlich auch gute Entscheidungen getroffen. Meine Kinder gehen mittlerweile auch gerne in die Schule.-Was sind denn die Herausforderungen im Bildungsbereich? Was unterscheidet denn Wien da jetzt zum Beispiel von einer ländlicheren Umgebung?-Wir haben in Wien natürlich große Herausforderungen, das ist aufgrund unserer demographischen Entwicklung schon gegeben. Wir sind eine Millionenstadt, die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum. Und wenn man es im ländlichen Bereich oder mit kleineren Städten vergleicht, dann ist einmal die Frage der Dimension eine ganz andere. Natürlich ist es Zuwanderung, viele Kinder, die hier nicht deutsch sprechend in unser Bildungssystem gelangen. Und das erfordert viele politische Maßnahmen, um diese Kinder zu integrieren und im Gesamten ein Schulumfeld zu schaffen, wo alle gefördert werden, wo alle gestärkt werden, wo alle ihre Talente entdecken können. Und auch, und das vielleicht noch ein bisschen zu meiner Vision und zu meinem Ziel, dass alle Kinder gerne in die Schule gehen.-Welche konkreten Pläne haben Sie denn da? Ihr Vorgänger hat da ja schon einiges auf den Weg gebracht. Wo wird es weitergehen und was sind da neue Ansätze, die kommen werden?-Für mich ist ganz wichtig, dass jedes Kind den guten Schuleintritt schafft, indem es auch gut Deutsch lernt. Und das ist eine Mammutaufgabe, das wissen wir auch aus aktuellen Zahlen. Aber das Deutschlernen ist eben ist obligatorisch und ganz wesentlich, um eine gute Bildungslaufbahn zu starten und auch danach ein geglücktes Leben zu führen und seinen Weg zu machen. Und ich möchte hier im Kindergarten, wir haben Christoph Wiederkehr noch mit der Mission Deutsch begonnen, hier einen klaren Fokus darauf zu legen, dass wir unsere Bemühungen intensivieren müssen. Und da möchte ich ganz klar weitermachen, indem wir die Sprachförderkräfte ausbauen im Kindergarten, aber auch, indem wir die Lesepaten und Lesepatinnen in den Kindergarten, in die Kindergärten schicken. Das ist ja, wenn ich es erzählen kann, ein Erfolgsprojekt auch in der Schule. Da gibt es über 1000 Lesepaten und Lesepatinnen, die sind Freiwillige aus der Mitte der Gesellschaft, pensionierte Lehrkräfte oder auch eine Unternehmensberaterin, die sagt, ich würde gerne etwas an unsere Gesellschaft weitergeben. Es ist mir wichtig, dass hier ein Fortschritt passiert. Ich möchte auch den Kindern was geben. Ich bin gerne mit Kindern und die kommen an die Schulen und verbringen hier stundenweise, das können sie sich autonom mit der Schule ausmachen, stundenweise mit dem Lesen und somit dem Deutsch-Erwerb für die Kinder. Und dieses Modell möchte ich auch in die Kindergärten bringen. Also quasi ein gemeinschaftliches Gesamtprojekt unserer Gesellschaft, wie wir diese Kinder unterstützen und gut für die Schule vorbereiten.-Das heißt, da sind auch Freiwillige gesucht für dieses Projekt?-Da sind Freiwillige gesucht. Wir haben auch schon aufgerufen. Es haben sich auch in den ersten Tagen schon relativ viele gemeldet. Und natürlich noch nicht zu Ende, aber wir wollen bald wirklich, in den Kindergärten starten mit einem Grundstock, der hier einiges weiterbringen kann.-Sie haben ja jetzt in Ihren ersten Tagen als Bildungsstadträtin schon Schlagzeilen gemacht. Sie wollen die Hausaufgaben abschaffen. Was heißt denn das?-Es liegt natürlich nicht in meiner Hand, die Hausaufgaben abzuschaffen. Das muss man mal vorwegschicken. Sondern in der Schulautonomie, beziehungsweise ist es auch jede Lehrer und jede Lehrerin, die entscheidet, wie sie ihren Unterricht gestaltet, aber auch darüber hinaus, Hausaufgaben mitgibt. Für mich sind Hausaufgaben auf vielen Faktoren ein Thema, das man vielleicht ein bisschen neu betrachten muss. Sie fördern die soziale Ungleichheit. Wir haben Kinder, die zu Hause Unterstützung bekommen, wo die Eltern sehr intensiv die Hausübungen mitmachen, würde ich fast schon mal sagen, bis darüber hinaus sogar. Und Kinder, die hier keinerlei Unterstützung haben, die vielleicht auch organisatorisch noch nicht so aufgestellt sind, dass sie das überhaupt bewerkstelligen können, dass sie wissen, sie müssen am nächsten Tag die Hausübungen abliefern. Und das ist eine Ungleichheit, die aber dann auch beurteilt wird. In der Schule bringe ich die Hausübung, bringe ich sie nicht? Ist sie gut gemacht oder eben nicht? Und das ist auf der einen Seite ein Thema. Auf der anderen Seite sind die Hausaufgaben, und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, auch ein bisschen ein Familienkiller. Das ist ein hartes Wort. Sie kennen das auch. Ist ein hartes Wort, aber wenn ich mir denke, wie lange meine Kinder in der Schule sind, also bis 13.40 Uhr eine sechste Stunde dauert, dann gab es aber noch keine Mittagspause, immer nur 10 Minuten Pause. Und dann gibt es mal Heimkommen, vielleicht gibt es auch noch ein Freizeitprogramm, einen Fußballverein oder sonstiges, das Zeit erfordert. Und wenn dann berufstätige Eltern erst am Abend heimkommen und eigentlich dieser Abend auch natürlich da ist, um Freizeit zu verbringen mit seinem Kind, ein gemeinsames Abendessen zu haben, sich darüber auszutauschen über den Tag und dann um halb zehn noch ein Kind kommt und sagt, ich habe noch eine Hausübung für morgen, dann ist das, glaube ich, kein Einzelfall, sondern kommt sehr, sehr oft vor. Und das führt auch zu Konflikten natürlich zwischen Eltern und Kindern, die man vermeiden könnte. Und ein dritter Aspekt ist bei den Hausübungen noch wesentlich, dass gerade Kinder in einem höheren Alter ihre Smartphones und Medien natürlich auch nutzen, um hier sich Hilfe zu holen. Bei den Hausübungen würde ich mal sagen, also Chat-GPT kann das wunderbar lösen. Und dann stellt sich natürlich die Frage nach, was habe ich mir jetzt selbst erlernt dadurch, muss man sowieso in Zweifel ziehen, weil das einfach nicht mehr gegeben ist. Und es geht mir in der Debatte auch gar nicht darum zu sagen, wir müssen hier runter von einem Leistungsanspruch, weil ich bin dafür, dass Kinder das selbstständige Lernen und Erarbeiten eines Stoffes wirklich üben und auch selbstständige Aufgaben machen. Aber diese alleinige Beurteilung von Hausaufgaben und wie das oft in einen Alltag passt, das finde ich ein Thema. Vielleicht auch noch ein Aspekt dazu, eine Ganztagesschule, die wir in Wien ja massiv ausbauen, gibt im Prinzip keine Hausaufgaben mit, weil hier alles im im schulischen Umfeld erarbeitet wird, auch von den Kindern selbstständig. Und ich bin überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist.-Sie haben jetzt schon von den Handys gesprochen und die Hilfe, die die Kinder sich dabei holen. Führt mich jetzt zum Handyverbot an den Schulen, das hat ja auch für Aufregung gesorgt. Wie stehen Sie denn da dazu?-Ich bin sehr froh, dass es hier jetzt diese Klarheit gibt und einheitliche Regelungen. Ich weiß, das Handy ist ein Konzentrationskiller. Das weiß auch jeder erwachsene Mensch, das weiß auch ich sehr gut. Man lässt sich sehr leicht ablenken, wenn man irgendwo mal gefangen ist und sich durchscrollt. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen merke ich es, da gibt es dann irgendwo kein Ende. Mitgenommen haben sie daraus gar nichts, eher vielmehr noch an Belastung, weil sich das ja auch zusätzlich beschäftigt. Aber in der Schule hat ein Handy aus meiner Sicht nichts verloren. Es haben viele Schulen schon den Schritt gestartet, mit Handyverboten, aber in Wahrheit waren dann die Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Schulleitung auch selbst gefordert, hier das zu kontrollieren und hat zu einer zusätzlichen Aufgabe eigentlich geführt. Und mit dieser Klarheit kann man jetzt auch den Schülerinnen und Schülern und viele befürworten es sogar, das ist ja ganz lustig in dieser Debatte, dass man sagt, das Handy wird am Anfang des Unterrichts weggelegt, wirklich weggesperrt und zum Ende des Unterrichts wird es wieder ausgegeben. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, vielleicht für die psychische Gesundheit. Ich habe es vorhin angesprochen, dieses sich verlieren in diesem medialen Raum, der nichts Gutes mit einem macht, der auch schlechte Gedanken macht zum Teil. Und diese mentale Gesundheit ist gerade für Kinder und Jugendliche ein riesengroßes Thema, vor allem wenn wir uns anschauen, was hat die letzte Zeit mit diesen Kindern gemacht. Und da fangen wir an natürlich mit Corona, aber auch Krieg in Europa, durch Russland in der Ukraine, Zuwanderung. Das heißt eine sehr krisenbehaftete Umgebung, die Verunsicherung natürlich auslöst. Und dieses gerne in die Schule gehen, wie ich es vorhin angesprochen habe und dann auch mit Handy, das spielt für mich alles zusammen. Und dem gerne in die Schule gehen, auch die psychische Gesundheit der Kinder weiterhin zu stärken, weil ich glaube oder bin wirklich überzeugt davon, dass wir in den nächsten Jahren einen Fokus darauf haben müssen.-Was kann die Schule da leisten zum Thema mentale Gesundheit?-Ganz wichtig, dass man hier auch aus der politischen Verantwortung heraus tätig wird, weil Lehrerinnen und Lehrer haben einen sehr herausfordernden Job und eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Der ist natürlich auch einen Stoff zu vermitteln. Viele sagen, sie sind auch Sozialarbeiter und deswegen gehören sie in dieser Frage auch wirklich unterstützt. Und das machen wir, indem wir Unterstützungspersonal an die Schulen holen, Schulsozialarbeit ausbauen, aber jetzt auch ganz aktuell mit dem Projekt der School Nurses in die Schulen gehen. School Nurses ist ein Gesundheits- und Pflegepersonal, das wirklich am Schulstandort ist und hier neben allen gesundheitlichen Belangen auch die mentale Gesundheit, psychosoziale Probleme oder Krisen, die teilweise auftreten, mitnehmen. Eine Person, die die Schüler*innen am Standort kennt, weiß, welche Bedürfnisse gerade herrschen und sie möglichst gut mitnimmt auf diesem Weg. Dieses Projekt haben wir in den letzten Jahren als Pilotprojekt gestartet und wird jetzt ausgerollt, jetzt auf 40 Schulen. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Ansatz, also ich weiß, dass er erfolgsbringend ist, das hat auch die erste Evaluierung schon gezeigt, aber ich bin auch überzeugt, dass das ein ganz wesentlicher Faktor für die Schulen in Zukunft sein wird.-Themen wie mentale Gesundheit, das Handy oder Deutsch lernen, das sind Themen, die liegen einerseits in der Verantwortung der Eltern, aber auch in der Verantwortung der Schulen. Wie würden Sie denn da die Aufteilung sehen zwischen Eltern und Schule?-Wichtig ist, dass es ein gutes Miteinander gibt, weil in diesem Bildungsdreieck Eltern, Schule und Kinder müssen alle zusammen helfen. Es geht nicht darum, dass etwas nur bei der Schule liegt oder auch nur bei den Kindern. Es braucht jeder Unterstützung gleichermaßen. Wir haben auch ganz dezidiert Projekte gefördert, die sich diesem Thema widmen, also wie Elternarbeit an der Schule besser gelingen kann. Und hier wirklich auch Workshops angeboten an Schulen. Und da sind ganz innovative Ansätze auch entstanden, wie das gut gelingen kann. Also für mich wesentlich, es muss im Einklang sein, es müssen alle an einem Strang ziehen und so kann das auch gut funktionieren. Für mich ist wichtig, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer oder die Schule nie alleine lassen und sie immer auch eine weitere Stelle haben, wo sie Unterstützung erfahren können. Das ist die Bildungsdirektion und das ist schlussendlich auch meine politische Verantwortung hier. Alles für die Und damit bereitzustellen, dass den Lehrerinnen und Lehrern am Schulstandort hilft.-Lehrermangel ist auch so ein Schlagwort. Was ist da geplant? Wie kann man da helfen?-Das ist leider ein riesengroßes Thema, dieser Personalmangel. Auch leider nicht nur im Bildungsbereich. Wir sehen es auch, wenn wir in den Gesundheits- und Pflegebereich blicken. Und das hat sich über die letzten Jahrzehnte in Wahrheit schon abgezeichnet. Und man muss auch sagen, zu spät reagiert. Jetzt haben wir die vollen Auswirkungen davon zu spüren, auch mit einer großen Pensionierungswelle. Und hier gilt es, alle Maßnahmen zu setzen, die dem entgegenwirken. Es wurde ja auf Bundesebene auch einiges getan. Wichtig ist, dass wir Lehrpersonal oder Bildungspersonal in Summe gegenüber unsere volle Unterstützung anbieten. Dass sie auch eine moderne, angenehme Arbeitsumgebung haben. Das ist auch unsere Aufgabe. Dass sie sich wertgeschätzt fühlen für diesen wichtigen Beruf. Und dass wir à la longue natürlich aus diesem Personalmangel wieder herauskommen indem wir das vermitteln und den Lehrerinnen und Lehrern auch klar machen, wie wichtig sie sind, wie sehr wir sie brauchen. Und durch verschiedenste Unterstützungsmaßnahmen ihnen den Job in der Schule erleichtern. Und dieses den Job in der Schule erleichtern ist etwas wie ein Handyverbot, ist etwas wie das Projekt des Wiener Bildungsversprechens. Wo wir Schulen mit besonderen Herausforderungen explizit fördern. Da bekommen Lehrerinnen und Lehrer auch ein Coaching. Da werden sie begleitet, auch in ihren Unterrichtsmethoden, wie sie zum Beispiel mit konfliktreichen Situationen umgehen. Und das sind alles Maßnahmen, die in ihrer Summe in dieses Feld hineinwirken sollen.-Wird es für Sie als Bildungsstadträtin jetzt leichter, Maßnahmen umzusetzen mit mehr Rückendeckung oder mehr Rückenwind aus dem Bund?-Ich habe jetzt den großen Vorteil, dass Christoph Wiederkehr das Wiener Bildungssystem gut kennt. Einen guten Blick hat darauf, was sind die Herausforderungen in Ballungsräumen. Das hatten wir vorher definitiv nicht. Hier wurde auch ein bisschen Bund gegen Land ausgespielt. Beziehungsweise war es immer auch sehr konfliktträchtig, diese Diskussion. Und indem wir jetzt ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, also die Bundesregierung umsetzen will, aber auch ein Chancenindex, den wir immer gefordert haben. Das heißt, wir brauchen eine andere Finanzierung und zwar mehr Unterstützung für die Schulen, die es besonders brauchen. Und das haben wir vor allem im Ballungsraum, nicht nur in Wien, sondern auch in Linz, in Innsbruck zum Beispiel ganz stark, dass wir hier mehr Finanzierung bekommen.-Sie haben vorher schon die mentale Gesundheit angesprochen, die Ihnen ein besonderes Anliegen ist. Wie sieht es denn mit der körperlichen Gesundheit aus? Immer mehr Menschen, immer mehr Kinder auch sind übergewichtig. Sie ernähren sich unregelmäßig, einseitig. Welchen Beitrag kann denn da die Schule leisten, um das zu verbessern?-Ich glaube auch, also Bewegung ist enorm wichtig. Kinder müssen sich bewegen, Freiräume haben. Ernährung spielt eine große, große Rolle. Und ich habe es vorher schon angesprochen, ein Tag, der bis 13. 40 Uhr dauert und ich habe keine Mittagspause, dann sagt mir der Hausverstand schon, dass das wahrscheinlich nicht sehr gesundheitsfördernd ist, wenn ich mir auch die Ruhe und die Zeit nicht nehmen kann, ein Essen bewusst zu mir zu nehmen. Und das ist wirklich ein großer Faktor. School Nurses sind ein Aspekt in der Geschichte, die ja auch hier die gesundheitliche Perspektive von Kindern im Blick haben sollen, auch zum Beispiel was Übergewicht betrifft oder schlechte Essgewohnheiten. Und natürlich für mich besonders wesentlich ist, wir haben ja das kostenfreie Essen in den ganztägig geführten Schulen. Und mein Wunsch ist hier in allen schulischen Einrichtungen, beziehungsweise auch in den Horten, in Zukunft ein kostenfreies Essen, warmes Essen anzubieten, weil das ein ganz erheblicher Faktor ist für die Gesundheit und auch dafür, dass man einen Schultag genießen kann. Genießen werden wahrscheinlich einige nur sagen, na, wie soll das gehen? Aber schon einen Tag erleben kann, der auch unseren natürlichen Bedürfnissen gerecht wird. Und ich sehe vielerorts, dass wir davon eigentlich weit weg sind oder manchmal nur ein Stück weit weg sind. Und wir Kindern schon viel zu muten.-Der Tag wird schon auch lang für die Kinder, ja.-Wir haben jetzt über einige Themen gesprochen, die Sie als Bildungsstadträtin jetzt hauptsächlich beschäftigen werden. In der nächsten Zeit kommen wir zu einem Thema, das Sie als Vizebürgermeisterin auch beschäftigen wird. Und Sie kommen ja aus einem Bereich, der sich auch mit der Umwelt und mit dem Klima beschäftigt. Ja. Der Winter war zu warm, zu trocken, zu schneearm. Tut Wien da genug, um gegenzusteuern?-Wir haben gerade in den letzten viereinhalb Jahren unserer Fortschrittskoalition bzw. mit Eintritt von uns und ab 2020 hier einen starken Fokus darauf gerichtet, wie gehen wir mit Klimaschutz per se um, aber auch mit Klimawandelanpassung in der Stadt. Es wird trockener, es wird heißer und auch das Lebensumfeld für die Menschen verändert sich. Man spürt das vielerorts, wenn Menschen hier keine entsprechende Kühlung irgendwo in Anspruch nehmen können, dass es sehr heiß wird, auch in Wohnungen. Und das ist ein großes Thema, das die Stadt beschäftigen muss. Im Bereich des Klimaschutzes haben wir immer gesagt, wir brauchen ein Klimagesetz, um diese Verbindlichkeit auch herzustellen. Wir können uns viele Maßnahmen vornehmen. Und da ist in den letzten viereinhalb Jahren auch wirklich viel passiert, was wir auf den Boden gebracht haben. Aber das Klimagesetz ist unser verbindlicher Rahmen, der uns Politiker*innen ganz klar sagt, dazu haben wir uns verpflichtet. Das ist, bis 2040 klimaneutral zu sein. Und der Klimafahrplan, der dann quasi dahinter liegt, gibt ein Maßnahmenbündel vor, in welchen Bereichen wir hier Schritte setzen. Und da kann ich nur kurz vielleicht erwähnen, auch an die Initiativen zu Raus aus Gas, der ganzen Wohnraumoffensive und -Sanierung. Aber auch der Radwegeausbau gehört dazu. Wir haben in diesen fünf Jahren jährlich fünfmal so viel investiert in den Radwegeausbau. Wie davor zum Beispiel. Und das sieht man auch, wenn man jetzt auf die Straßen schaut und in Wien herumgeht. Das ist wirklich enorm, was hier errichtet worden ist. Und eine umweltfreundliche Mobilität hilft natürlich auch dem Klima. Weniger Schadstoffe in der Stadt, heißt auch bessere Luft. Wir sind wieder bei der auch besseren Gesundheit dadurch. Und das ist eine Win-Win-Win-Situation, wenn wir das machen. Wir bauen aber auch coole Schulen. Das heißt, jeder Schulraum oder jeder Schulbau, der neu errichtet wird, wird nach neuesten energietechnischen Standards errichtet. Auch im Gesundheits- und Krankenhausbereich zum Beispiel. Das beginnt bei den Photovoltaikanlagen, geht über Erdwärme, Fassadenbegrünungen, schattige Plätze, der perfekten Ausrichtung nach der Sonne. Und das sind alles Faktoren, wie wir, glaube ich, mit diesem gesamten Klimafahrplan die Klimaneutralität bis 2040 im guten Blick haben. Trotzdem eine große Herausforderung, auch das auf den Boden zu bringen.-Wie bewegen Sie sich in der Stadt? Trifft man Sie in der U-Bahn, trifft man Sie am Rad an?-In der Straßenbahn. U-Bahn brauche ich gar nicht, weil ich das Glück habe, nur eine Straßenbahn ins Rathaus benutzen zu müssen. Das mache ich im Winter und wenn es mir zu kalt ist. Aber sobald es irgendwie geht, sitze ich wirklich am Rad und fahre täglich mit dem Rad ins Büro und retour. Hält auch fit? Hält fit, bringt gute Luft und man bleibt gesund.-Die Politik ist ja ein hartes Pflaster, glaube ich. Was tun Sie denn für sich, für Ihre mentale Gesundheit, zu Ihrer Entspannung?-Das Radfahren fällt mir als erstes ein, weil ich es auch wirklich täglich einbauen kann. Ich höre auch keine Musik beim Radfahren, das machen ja viele.-Ist auch glaube ich, gefährlich, oder?-Man kann es schon bewerkstelligen, indem man es nicht zu laut macht. Man muss die Umgebung schon im Ohr haben, sage ich mal. Ich mache das gar nicht, weil ich dann ganz wirklich bei mir bin und diese 25 Minuten eine Richtung wirklich genieße. Und sonst natürlich diese tägliche Bewegung. Frische Luft, spazieren gehen, die Zeit mit meinen Kindern, aber auch Treffen mit Freunden, wo man mal über ganz was anderes reden kann und gemeinsam lachen und wo Politik nicht so eine Rolle spielt und man einfach über Privates plaudert. Da kann ich mich gut rausnehmen und mal auch abschalten.-Wie war das Feedback von Ihrem Umfeld zu Ihrer neuen Position, von Ihren Kindern, von der Familie, von den Freunden?-Ja, große Freude natürlich und viele Glückwünsche habe ich bekommen. Auch meine Kinder waren sehr erfreut. Die haben es gar nicht geglaubt. Wie, was machst du da jetzt? Ja, es ist ein schönes Gefühl auch, wenn man so viel Wertschätzung erfährt.-Ein Thema, das Wien jetzt im März beschäftigt hat, war die Frauenwoche, Chancengerechtigkeit, Gewaltschutz. Altersarmut sind so Themen, die da im Mittelpunkt standen. Was ist Ihnen denn da als Vizebürgermeisterin ein besonderes Anliegen?-Frauenpolitik ist immer ein Querschnittsthema. Und da gibt es viele Aspekte, auf die man schauen muss und viele Aspekte, wo man auch hingreifen kann und Maßnahmen setzen kann. Wie ich auch meine Rolle ein bisschen definiere, das ist auch zu zeigen, dass man als Frau viel erreichen kann. Dass man auch Role Model, gerade in der Politik, braucht es Sichtbarkeit von Frauen. Vereinbarkeit mit Familie und Beruf ist immer wieder ein Thema. Und ich sehe mich schon auch in der Verantwortung zu zeigen, man kann das auch schaffen. Und man kann das machen und Frau kann das. Und deswegen finde ich das auch besonders wichtig. Aber sonst natürlich Gewaltschutz, angstfreier Raum, gerade beim Weggehen. Also meine Tochter ist jetzt im Teenageralter noch nicht so, dass sie weggeht, aber es wird bald kommen. Und natürlich ist hier die Sicherheit ein wesentlicher Aspekt. Wie kann sie sich sicher fühlen in der Stadt? Beleuchtung ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ist der Heimweg beleuchtet genug? Wie sehr kann man darauf vertrauen, dass sie gut nach Hause kommt? Oder auch K. O.-Tropfen in Clubs oder Ausgeh-Lokalen. Hier gibt es ja eine große Kampagne der Frauen-Stadträtin, die ich sehr begrüße, um den Fokus darauf zu lenken. Und sicher extrem wichtig und wesentlich. Aber Frauenthemen gehen weiter. Es beginnt bei der finanziellen Unabhängigkeit, ein Pensionssplitting, Karenzzeiten, die noch immer nicht selbstverständlich auf Mann und Frau gleichermaßen aufgeteilt sind. Ich habe das immer gesagt. Frauen haben natürlich immer auch im Job den Nachteil, dass auch bei einer Einstellung von jungen Frauen natürlich gedacht wird, na ja, wo führen die Karrierewege hin? Was kann man hier investieren? Wird sie ausfallen oder nicht? Und bei dem Mann ist dieser Gedanke automatisch weniger da bei einer Einstellung. Und ich finde, davon müssen wir weg. Also es muss normal sein, dass Mann und Frau gleichermaßen in Karenz gehen, dass das keinen Unterschied mehr macht. Und da haben wir echt noch viel zu tun.-Wie würden Sie denn Ihren Führungsstil beschreiben? Sie haben jetzt ja ganz, ganz viele Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten.-Ich bin sicher sehr kooperativ. Also ich höre mir viele Meinungen an, bevor ich auch Entscheidungen treffe. Und gebe das auch Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit, dass ich sie sehr einbeziehe. Ich bin immer auch sehr freundschaftlich. Und ich werde auch nie laut. Würde man, glaube ich, auch nicht erwarten von mir. Und ja, wichtig ist für mich einfach, dass Anliegen, Bedürfnisse von Mitarbeitern ganz wichtig sind. Und man auch Grenzen setzt, was es betrifft, Freiräume einzuhalten. Das heißt, wenn Arbeitsschluss ist, dann ist das auch so. Und es ist mir sehr wichtig, hier eine gute Balance für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden.-Welche drei Eigenschaften würden Sie denn jetzt nennen, wenn ich sage, beschreiben Sie sich bitte?-Ich bin konsensorientiert. Was meinen politischen Weg betrifft. Dann würde mich das sicher am besten beschreiben. Sonst bin ich auch sehr gesellig. Ich liebe es, unter Menschen zu sein. Und ehrgeizig, doch auch ein Stück weit. Ich bin auch fürsorglich, würde ich sagen. Ja, waren eh schon vier.-Waren schon vier, das stimmt. Abschließend, wo sehen Sie denn Wien in 20 Jahren? Was wäre denn so Ihr Ziel? Da wollen wir hin, in die Richtung. Sollte sich unsere Stadt bewegen?-Also meine Vision für die Stadt per se, das ist, dass jeder Mensch hier frei leben kann. Nach seinen Vorstellungen, Wünschen und Bedürfnissen. Dass es hier keine Schranken gibt. Für Kinder schon nicht. Indem man ihnen alle Chancen gibt. Indem die Schule ums Eck immer die beste Schule ist. Das wäre meine Vision. Dass wir tatsächlich, Sie haben gesagt 20 oder 30 Jahre, dann tatsächlich klimaneutral sind. Unser Ziel auch zu erreichen. Und wir, das als Wien-Lebende auch tatsächlich spüren, dass diese Stadt auch grüner geworden ist. Dass wir noch viel mehr Projekte im Bereich der Entsiegelung durchgeführt haben. Dass es schön ist, hier zu leben. Und dass es ein gutes Miteinander in einer guten Wertegemeinschaft gibt. Wo das gegenseitige Zusammenleben einfach eine große Rolle spielt. Und jeder aber akzeptiert und toleriert wird, wie er oder sie ist.-Eine vielfältige, grüne...-Immer offene, grüne Stadt. Mit allen Chancen für Kinder. Und auch vielleicht noch ein Ziel oder eine Vision. Die kinder- und jugendfreundlichste Stadt der Welt zu werden.-Vielen Dank. Das sind schöne Wünsche für uns.-Ich freue mich. Sehr gerne. Danke. Ich.-Danke Ihnen für unseren Besuch im Studio. Danke fürs Kommen.-Sehr gerne. Danke für die Einladung. Dankeschön.-Zu Gast bei Christine Oberdorfer war Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.