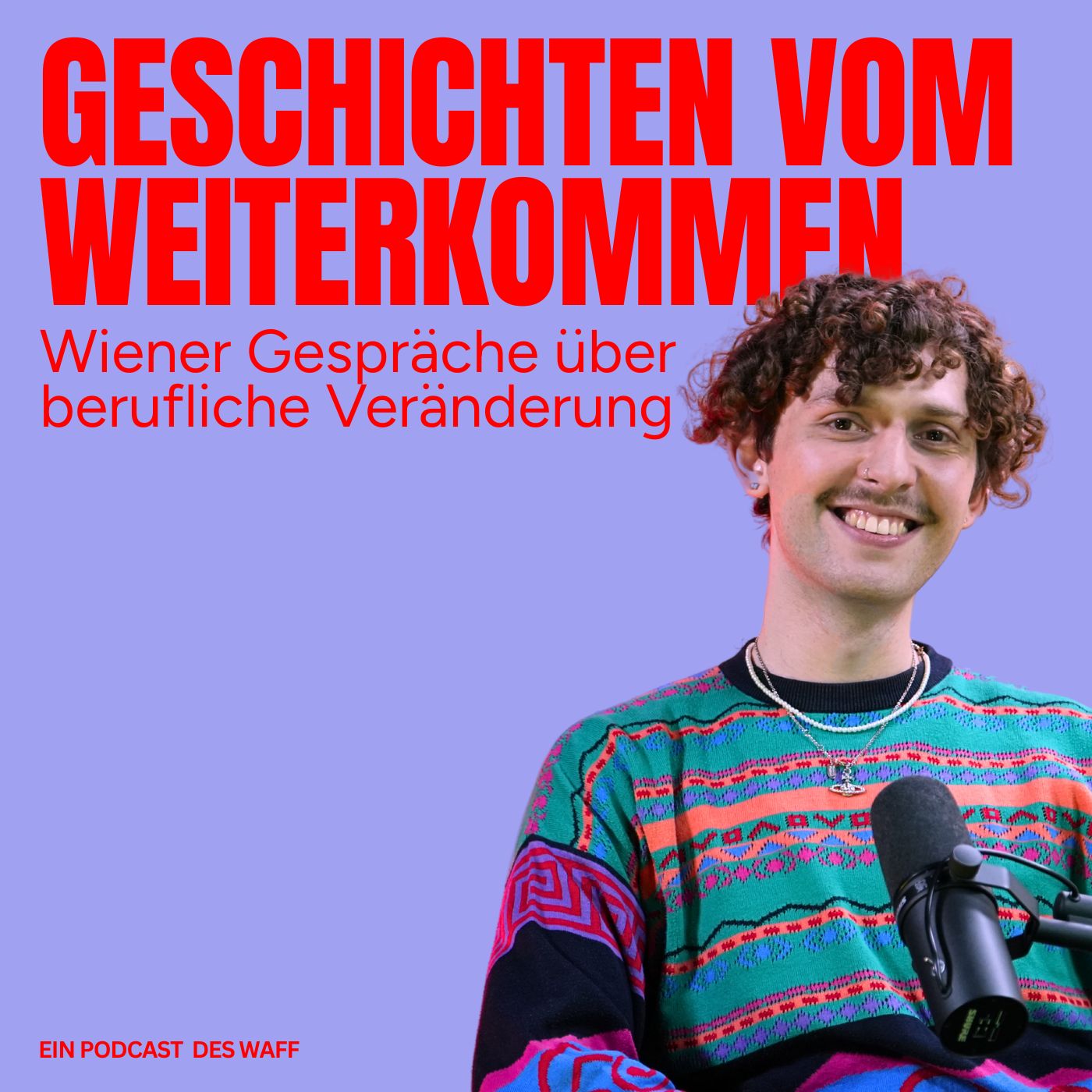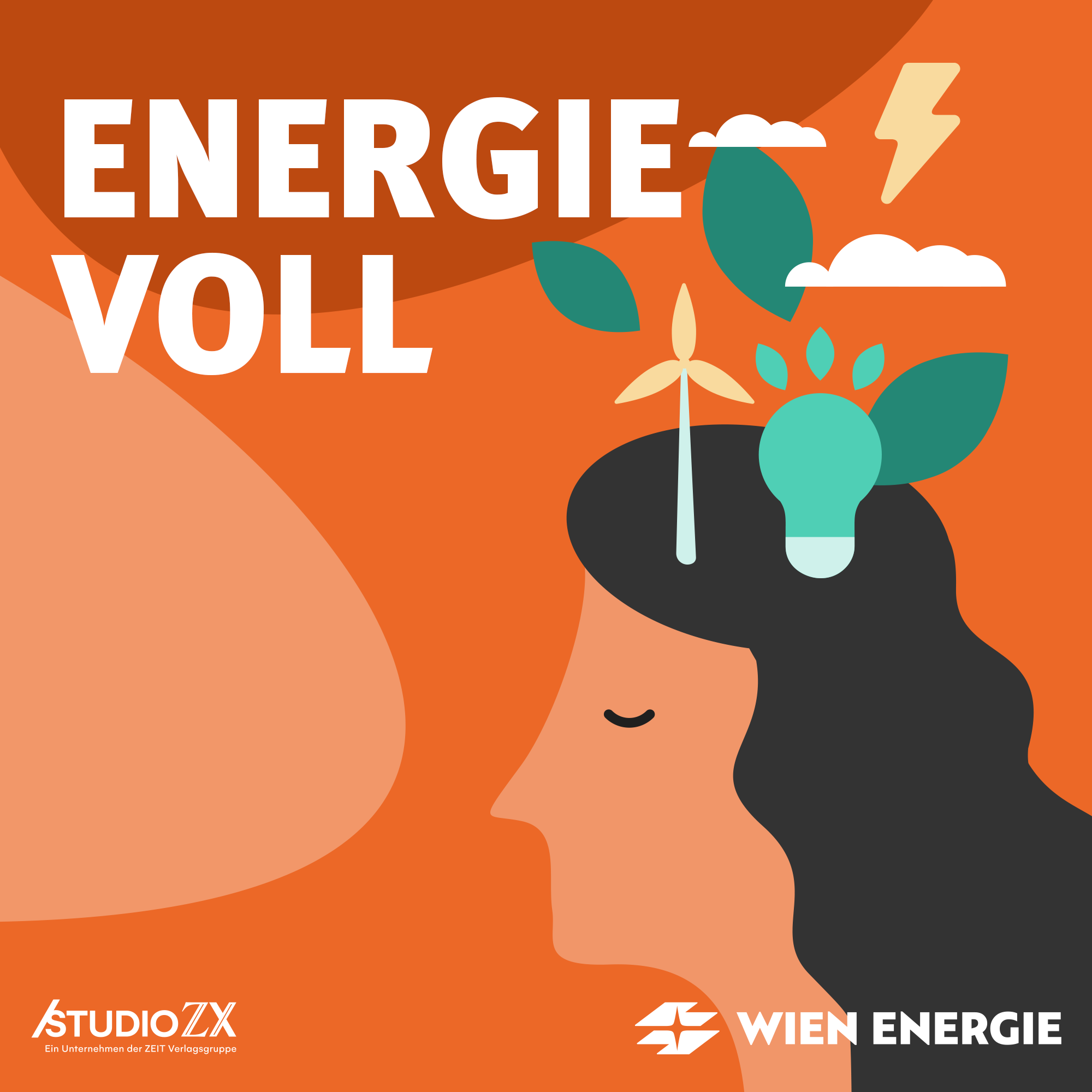Stadt Wien Podcast
Stadt Wien Podcast
Wiener Klimateam - Wie Bürger*innen Grätzl klimafreundlich gestalten
Mit dem Wiener Klimateam setzt die Stadt Wien auf innovative Bürgerbeteiligung: Wiener*innen können aktiv mitgestalten und ihre Ideen für mehr Klimaschutz im eigenen Grätzl einbringen. Doch wie funktioniert der Prozess genau? Wie werden Vorschläge bewertet? Und wer entscheidet über die Umsetzung?
In dieser Podcast-Folge gibt Mein Wien-Redakteur Bernhard Ichner spannende Einblicke. Zu Gast sind Wencke Hertzsch (Büro für Mitwirkung der Stadt Wien) und Martin Haselmayer (Foresight-Institut), die erklären, wie Bürger*innen-Jurys arbeiten und welche Projekte gefördert werden.
Mehr zum Klimateam: https://klimateam.wien.gv.at/
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert (falls ihr das noch nicht gemacht habt).
Feedback könnt ihr uns auch an podcast(at)ma53.wien.gv.at schicken.
Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen:
https://www.facebook.com/wien.at
https://bsky.app/profile/wien.gv.at
https://twitter.com/Stadt_Wien
https://www.linkedin.com/company/city-of-vienna/
https://www.instagram.com/stadtwien/
Und abonniert unseren täglichen Newsletter:
http://wien.gv.at/meinwienheute
Weitere Stadt Wien Podcasts:
- Historisches aus den Wiener Bezirken in den Grätzlgeschichten
- büchereicast der Stadt Wien Büchereien
-Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien, durch den Sie Mein Wien-Redakteur Bernhard Ichner führt. Thema des heutigen Podcasts ist das Wiener Klimateam, durch das die Stadt Wien neue Wege der Beteiligung und Zusammenarbeit geht.-Wir begrüßen bei uns im Studio die Wencke Hertzsch und den Martin Haselmayer. Könnt ihr beide euch einmal ganz kurz selber vorstellen? Ja. -Mein Name ist Wencke Hertzsch , ich leite das Büro für Mitwirkung in der Abteilung Energieplanung für die Stadt Wien.-Und der Herr Haselmayer?-Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Foresight-Institut und betreue quasi den Auswahlprozess, den statistischen, vom Klimateam.-Perfekt, dann gehen wir gleich in medias res. Es geht ja ums Klimateam. Da werden gemeinsam mit der Zivilbevölkerung klimarelevante Projekte gesucht, die dann von der Stadt Wien gefördert, in der Umsetzung gefördert werden. Und im vergangenen Herbst konnten die Wienerinnen und Wiener da ihre Ideen einmal einbringen, zum Thema erneuerbare Energie, Nachhaltigkeit im Alltag, klimafreundliche Mobilität und klimafritterStadtraum. Frau Hertzsch, sind Sie mit dem Rücklauf zufrieden? Wie viele Ideen sind denn da so hereingekommen?-Also wir sind im Wiener Klimateam sehr zufrieden mit dem Rücklauf der Ideen in diesem Jahr bei den teilnehmenden Bezirken. Wir haben mehr als 1.600 Ideen erreicht, so viele wie noch nie, also nicht vergleichsweise in den Vorjahren und auch von der Qualität so gut wie noch nie. Also was auch dafür spricht, dass das Thema schon besser verstanden wird und dass sozusagen der Zugang auch zum Thema immer besser gelingt.-Die thematische Aufteilung war entsprechend? Oder gibt es eine Säule von den Vieren, die ich aufgezählt habe, die besonders heraussticht? Oder ist das querbeet, so die Ideen?-Also es können Ideen für alle vier Themenbereiche eingebracht werden und auch alle Ideen streuen, das sage ich jetzt mal mehr oder minder, in allen Themenbereichen. Was wir die letzten Jahre natürlich schon festgestellt haben, dass Themen, die halt im Bereich Mobilität und auch im Bereich öffentlicher Raum sind. Potenziell eher etwas mehr Ideen sind als in den Aber es gibt ausreichend Ideen für alle Bereiche, sodass auch in der weiteren Bearbeitung der Ideen, in den weiteren Phasen, alle Themenbereiche immer noch berücksichtigt sind.-Und Sie haben es angesprochen, in den Bezirken haben Sie gesagt, damit ist gemeint am Alsergrund in Meidling und in Rudolfsheim-Fünfhaus, oder?-Genau, in diesem Jahr sind genau die von Ihnen genannten Bezirke dabei.-Okay, das war dann also quasi diese Ideenfindung, das war einmal die erste Phase. Dann gab es die zweite Phase, da haben, glaube ich, ungefähr 80 Fachleute der Stadt aus 25 Dienststellen und städtischen Unternehmen, habe ich gehört, diese Ideen auf ihre Umsetzbarkeit eingeschätzt. Nach welchen Kriterien eigentlich?-Vielleicht bevor ich sozusagen darauf eingehe, wie halt die Prüfung durch die Fachexpert*innen erfolgt, vielleicht nur nochmal den ersten Schritt davor, also diese 1600 Ideen, die wir erhalten haben, werden auch auf ihre Einreichkriterien hin überprüft. Ob sie sozusagen weiter bearbeiten.-Ob sie klimarelevant sind, ob sie überhaupt im Einflussbereich der Stadt sind und so weiter.-Ja, genau. Ob sie in zwei Jahren umsetzbar sind, ob sie den Zielen entsprechen. Und ja, und tun sie das, dann können wir eben mit diesen Ideen halt entsprechend weiterarbeiten. Und in dieser zweiten Phase, von der Sie gerade gesprochen haben, organisieren wir eben die mehr als 80 Fachexpert*innen der Stadt Wien aus geschäftsgruppenübergreifend aus 25 Dienststellen. Die dann eben diese Ideen fachlich einschätzen. Also ist diese Idee technisch umsetzbar? Ist diese Idee tatsächlich innerhalb dieser zwei Jahre umsetzbar? Liegt diese Idee auch im Rahmen des Gesamtbudgets, was zur Verfügung steht innerhalb dieser Bezirke, für die Bezirke? Entspricht die Idee der positiven Klimawirkung, nach der wir suchen? Und kommt diese Idee vulnerablen Gruppen zugute? sind sozusagen halt so diese Fachfragen, die wir den Expert*innen der Stadt mitgeben, anhand derer sie sozusagen zu einer ersten fachlichen Einschätzung kommen?-Okay, und das ist jetzt quasi, auch diese Phase ist abgeschlossen. Jetzt sind wir zumindest in diesen drei Bezirken, von denen wir vorher gesprochen haben, vom 9. vom 12. und vom 15. Und jetzt sind wir in der Phase 3, in der Projektentwicklung. Was ist das genau? Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Was passiert da?-Bevor wir in diese Phase kommen und zwischen dem, was die Expert*innen gemacht haben in dieser Ersteinschätzung und bevor wir in diese Phase 3 kommen, wo die Projekte entwickelt werden, passiert noch was ganz Essenzielles und in diesem Jahr auch etwas Neues sozusagen. Diese fachliche Einschätzung hat öffentlich auch stattgefunden. Also es gab in jedem Bezirk eine Ideenausstellung aller eingereichten Ideen, damit alle mal einen Überblick darüber bekommen, welche Ideen für den Gesamtbezirk auch eingereicht wurden. Und man konnte dann vor Ort im Rahmen dieser Ausstellung, haben wir auch da schon einen Workshop organisiert, mit den Fachexpert*innen der Stadt und den Ideengeber*innen und den Vertreter*innen von Bezirken und Einrichtungen, die uns begleiten, und da wurden die Ideen priorisiert. Also man hat dann, weil wir eben über 1600 Ideen sprechen, in Meidling beispielsweise sind das allein 700 Ideen, über die wir da sprechen. Das heißt, da muss auch priorisiert werden, mit verschiedenen Perspektiven, an welchen Ideen in Zukunft weitergearbeitet werden kann, weil sozusagen auch die Ressourcen zur Bearbeitung jeder einzelnen Idee ja auch überschaubar oder halt eben auch begrenzt ist. Das heißt, da hat schon mal ein Workshop stattgefunden, wo man die Ideen priorisiert hat. Die Ideen werden auch geclustert und zusammengeführt. Da, wo sie sozusagen thematisch gut zusammenpassen oder da auch, wo sie örtlich gut zusammenpassen.-Darf ich da ganz kurz dazwischen grätschen, bevor wir zur Beantwortung der eigentlichen Frage kommen? Wenn da so viele Ideen abgegeben werden, sind einander die Ideen nicht sehr ähnlich? Kommt da nicht sehr oft das Gleiche oder was sehr Ähnliches?-So und so. Also es gibt natürlich auch Ideen, die sich halt zum Teil sehr ähnlich sehen. Also es geht dann sehr viel um Begrünung oder auch halt Kühlung im öffentlichen Raum oder auch Beschattung. Das ist sozusagen das Bedürfnis, das dahinter liegt, ist oft das Gleiche. Oder halt eben die Förderung des Fußverkehrs. Also da sehen wir halt immer wieder die gleichen Bedürfnisse. Und die Ideen können dann aber trotzdem sehr unterschiedlich sein, weil, und das ist das Wichtige auch, wir ja auch sozusagen das lokale Wissen ja so stark abrufen. Von den Menschen, die daran teilnehmen. Weil wo dieser Baum dann steht oder wo wir ein Verschattungselement dann haben oder wo erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, hängt ja sehr viel halt irgendwie auch mit den örtlichen Gegebenheiten auch vor Ort zusammen und auch mit dem direkten Bedürfnis halt der Menschen. Und dann können die Orte und halt dann auch die Idee schon sehr unterschiedlich sein.-Haben Sie das Gefühl, wenn Sie da diese Ideen anschauen, sind das sehr reflektierte Ideen, wo die Leute zum Beispiel mitdenken, ist das leistbar, ist das umsetzbar oder kommen da auch so Briefe ans Christkind, wo man sich denkt, Leute, glaubt ihr das wirklich?-Na unser Zugang ist sowieso halt, die Idee kann groß oder klein sein und die Idee kann ausformuliert sein, also sehr stark ausformuliert und auch mit einem Projektplan sein. Und die Idee muss aber auch gar nicht so stark ausformuliert sein.-Aber gibt es die, die wirklich schon so strukturiert sind?-Es gibt alles. Also wir haben alles dabei. Wir haben viele Ideen, die sozusagen in einem Satz beschrieben sind mit einem Bedürfnis, aber wir haben auch sehr viele Ideen und das ist auch das, was mich eben auch schon besonders freut in diesem Jahr, sehen wir, dass die Qualität der Ideen, wo nochmal mehr dazu geschrieben wird, wo sozusagen schon Vorüberlegungen halt seitens der Ideeneinreicher*innen stattfinden, das hat schon ein Stück weit zugenommen, auch zu den letzten Jahren. Das heißt, die Thematik konnte in den letzten Jahren auch besser vermittelt werden.-Ist aber jetzt keine Vorentscheidung, also das heißt auch, wenn ich meine Idee einfach formuliere oder halt jetzt ohne technisches Know-how im Hintergrund, kann die auch in die engere Wahl kommen?-Ja, also das ist absolut kein Vorkriterium. Wir schauen auch, selbst wenn eine Idee aus nur einem Satz beschreibt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, schauen wir trotzdem, dass wir diese Ideen halt einfach gut zu einem Bündel zusammenfassen mit anderen Ideen, die entweder räumlich am gleichen Ort verortet sind oder die halt thematisch gut zusammenpassen, damit die Synergien zwischen den Ideen einfach auch besser genutzt werden. Also am Ende entsteht sozusagen halt aus den Ideen ein Ideencluster oder auch ein Ideenbündel, mit dem wir dann weiter arbeiten in der Projektwerkstatt.-Okay, dann sind wir glaube ich jetzt bei dem Punkt. Jetzt geht es eben um diese Projektentwicklung. Was ist konkreter als das Vorgehen?-Das konkrete Vorgehen in dieser Phase ist, aus den vorher schon entstanden und geprüften Ideen Projekte zu entwickeln. Und das heißt, diese Projekte zu entwickeln, dazu laden wir die Ideengeberinnen selber ein, aber auch eben die vorher schon genannten 80 Expertinnen aus 25 Dienststellen zu gemeinsamen Workshops. Dazu laden wir aber auch die Bezirke ein. Und wir laden eben auch noch Einrichtungen, in unserer Sprache heißt das Multiplikatorinnen, mit denen wir im Rahmen des gesamten Wiener Klimateams arbeiten. Und dann in diesen Workshops.-… Sind das diese Ideenwerkstätten, diese Workshops?-Die Ideenwerkstatt ist das, was ich vorher meinte, wo die Ideen priorisiert wurden in dieser Phase 2, wo sozusagen die Ideen eingeschätzt werden. Das ist die Ideenwerkstatt. Und die Projektwerkstatt findet jetzt gerade statt. Letzte Woche hat zum Beispiel eine im 15. Bezirk stattgefunden, diese Woche findet die nächste im 9. Bezirk statt. Und da werden aus diesen Ideen einfach konkrete Projekte entwickelt. Also das heißt, man schaut, welches Budget brauche ich jetzt wirklich, welche Maßnahmen, welche Maßnahmen-Schritte müssen gegangen werden und welche Maßnahmen überhaupt, um dieses Projekt und diese Idee, auch zu verwirklichen, welche fachzuständigen Dienststellen in der Stadt müssen identifiziert werden und wie kann sozusagen halt diese Idee auch als Umsetzungsprojekt, oder diese Ideen besser gesagt, als Umsetzungsprojekt gefasst werden. Am Ende entsteht so eine Art Projektskizze, ein erster Draft eines Projektes, was dann der Bürgerinnen-Jury in weiterer Folge vorgeschlagen wird.-Und zu diesen Workshops, kann da jeder Interessierte hinkommen oder ist das jetzt nur für die Leute, die schon in den bisherigen Projektphasen involviert waren?-Uns ist es ein großes Anliegen, dass alle dazu kommen können, die ein Interesse am Wiener Klimateam haben, unabhängig davon, ob sie eine Idee eingereicht haben oder nicht. Gleichzeitig ist es aber eben auch eine Einladung, da muss man sich dann auch anmelden, um bei den Workshops dabei zu sein. Man muss sich das vorstellen, das sind so große Ausplatzgründen. Es werden bis zu 80 Personen erwartet. Das muss organisiert und geplant werden. Und damit man das ungefähr gut einschätzen kann, braucht es halt irgendwie auch eine Form von Anregung.-Mitmaßlich Termine, die auch irgendwo an, zu Zeiten stattfinden, wo nicht jeder im PLO sitzt?-Genau, wir organisieren die Termine so, dass auch vor allem halt Menschen und die Wienerinnen, die halt daran Interesse haben, daran teilnehmen können. Das heißt, es findet in den späten Nachmittags, frühen Abends statt. Also nach der, nach vielen, wenn man die Arbeit schon hinter sich hat. Wir bieten auch Betreuungsleistung an für Menschen, die halt sozusagen Betreuungspflichten haben für Kinder. Das heißt, wir haben eine Kinderbetreuung vor Ort. Es gibt eine Verpflegung vor Ort, damit man irgendwie einfach auch gut genährt ist, um halt einfach über einen langen Zeitraum einfach gut zu diskutieren. Wir haben jetzt schon gesehen, in den zwei, in Meitling und im 15. Bezirk, haben in beiden jetzt in den letzten Wochen die Projektwerkstätten stattgefunden. Es war, jeder Platz war besetzt.-Ist das, ist das eigentlich Voraussetzung, dass die Menschen, die da teilnehmen möchten, die österreichische Staatsbürgerschaft haben?-Das ist zu gar keinem Zeitpunkt irgendwie eine Voraussetzung, um Teil des Wiener Klimateams zu sein, dass man die österreichische Staatsbürgerschaft hat.-Also jeder kann da teilhaben?-Jeder Wiener, jede Wienerin kann daran teilhaben. Wichtig ist, also auch an unseren Veranstaltungen können Interessierte teilnehmen. Ideen kann man einreichen, können auch alle Ideen einreichen. Die Idee muss halt einfach nur dem Bezirk zugutekommen, wo das Wiener Klimateam dann entsprechend stattfindet.-Und ohne, ohne jetzt einzelne Phasen des Projekts überspringen zu wollen, aber in einer, in einer nächsten Phase entscheidet dann pro Bezirk eine BürgerInnen-Jury, welche Projekte gefördert werden sollen. Wer sitzt denn eigentlich in so einer Jury, Herr Haselmayer?-Im Prinzip ist das relativ einfach. Teilnehmern und sich dafür interessieren kann jede Person, die im Bezirk einen Hauptwohnsitz hat und zum Stichtag des 16. Lebensjahres vollendet hat, also quasi wahlberechtigt ist. Ausgenommen sind hier auch Personen, die das Wahlrecht in Österreich haben, nicht. Also man braucht eben, wie vorher schon gesagt, keine Staatsbürgerschaft, um hier am Klimateam teilnehmen zu können. Und heuer ist noch ein drittes Kriterium dazugekommen, das heißt Personen, die ein Projekt selbst eingereicht haben, können auch nicht mitnehmen, teilnehmen an den Jury, einfach um Interessenkonflikte zu vermeiden. Und darüber hinaus gibt es eigentlich keine Kriterien. Also alle Personen, die den.-Befangenheit soll nicht vorliegen, aber ansonsten. Genau.-Aber wie kommt man in so eine.-Wie kommt man in so eine Jury hinein?-Also der Auswahlprozess verläuft im Wesentlichen in zwei Phasen und die Hauptkriterien sind eines purer Zufall. Also in der ersten Phase werden in den jetzigen Fällen 2000 Personen per Zufallsprinzip aus dem Melderegister gezogen. Diese Personen werden postalisch dazu eingeladen, am Klimateam teilzunehmen. Das heißt, sie bekommen einen Brief, da gibt es die zentralen Informationen, zum Klimateam, die da drinnen stehen. Es steht drinnen, was sie machen sollen oder was die Funktion dieser Juries ist und dass sie eingeladen sind, daran teilzunehmen. Und zu denen sie dann rückmelden? Genau, das ist der erste Schritt, da wird man eingeladen. Von diesen 2000 Personen registriert sich dann ein oder ist ein Teil davon interessiert. Bis jetzt sind das zwischen ungefähr 5 bis 8 Prozent Erfahrungswert von den eingeladenen Personen. Und wenn diese Personen dann teilnehmen möchten, dann müssen sie sich im nächsten Schritt diese Teilnahme bekunden. Das heißt, sie müssen bei einer Hotline anrufen oder einen Online-Fragebogen ausfüllen. Und zwar ist das wichtig, damit wir für den nächsten Auswahlschritt ein paar soziodemografische Kriterien über die Personen erhalten, weil das Ziel dieses zweiten Prozesses ist, dass die Jury im Endeffekt mehr oder weniger die Bezirksbevölkerung widerspiegelt. Das heißt, repräsentativ für diesen Bezirk ist. Also ein demografischer Querschnitt quasi. Genau, anhand von Kriterien wie Geschlecht, Alter, Einkommen, Beruf und Bildungshintergrund soll das dem jeweiligen Bezirk möglichst nahe kommen.-Und wie viele Leute sitzen dann tatsächlich drin in der Jury?-In den Juries, also das ist ein bisschen von der Bezirksgröße auch abhängig. Bei den größeren Bezirken sind es 25 Personen, bei den normalgroßen, kleineren Bezirken sind es 20 Personen, die diese Juries ausmachen. Und dann gibt es auch jeweils Ersatzmitglieder, falls noch durch Absagen jemand ausfällt. Und diese.-Juries müssen mehrheitlich entscheiden für ein Projekt oder müssen alle für ein Projekt sein? Wie funktioniert das so in der Abstimmung?-Also da bin ich tatsächlich nicht involviert. Also meine Aufgabe liegt tatsächlich nur in der statistischen Auswahl. Und um sicherzustellen, dass die Repräsentativität gewährleistet ist auf Basis der Bezirksdaten. Ich glaube, das muss ich jetzt an die Frau Hertzsch zurückspielen.-Aber was befähigt Sie jetzt dazu, diese Jury auszusuchen? Was machen Sie oder was macht diese Agentur für diese Arbeit?-Genau, also das, was wir machen, ist im Prinzip, wir sehen uns zunächst einmal die demografische, soziodemografische Verteilung in jedem Bezirk an, anhand der auswahlrelevanten Kriterien. Sagen Sie vielleicht.-Nochmal den Namen des.-Genau, also ich arbeite für Foresight und wir bei Foresight ziehen uns an, wie sieht die Bezirksbevölkerung aus, anhand der auswahlrelevanten Kriterien. Also wie ist die Geschlechterverteilung? Wie viele Menschen haben Migrationshintergrund in diesem Bezirk? Wie ist die Einkommensverteilung? Das ist quasi mal der Grund, den wir ungefähr, also die Grundlage, die wir ungefähr erreichen wollen. Also es geht hier nicht darum, möglichst präzise auf ein oder zwei Prozentpunkte, diese Bevölkerung abzubilden, sondern eine breite Repräsentativität zu erlangen. Also in ähnlichen Beteiligungsprozessen und die gültigen Standards, die angewendet werden, die gehen von dem Ziel aus, dass so aussieht, dass jede Person aus dem Bezirk, wenn sie oder er diese Jury ansieht, eine Person sehen sollte, mit der sie sich identifiziert oder eine Person, wo sie denkt, die ist mir ähnlich. Das ist ungefähr das Ziel dieser Jury. Diese Repräsentativität. Das ist natürlich unmöglich bei 20 Personen, dass jede Person perfekt abgebildet ist. Genau. Und um dieses Ziel zu erreichen, wenden wir einen statistischen Algorithmus an, der genau für solche Auswahlprozesse entwickelt wurde, der mittlerweile in über 100 ähnlichen Verfahren angewendet wird und eigentlich Standardprozedere ist, um eine sowohl faire als auch repräsentative Auswahl zu erreichen. Weil das Ziel dieses Algorithmus ist, einerseits eben das Ziel der Repräsentativität zu erreichen, also die vorgegebenen Quoten der Verteilung anhand den statistischen Kriterien zu erreichen und gleichzeitig aber auch individuell für jede Person, die sich registriert, sicherzustellen, dass die Auswahlchancen möglichst fair verteilt sind. Weil es gibt in den registrierten Personen starke Verzerrungen, also das kennen wir aus der Beteiligungsforschung, dass Menschen, die höher gebildet sind, die ein höheres Einkommen haben, Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, dass die sich stärker beteiligen wollen. Das fängt bei den Wahlen an, aber geht auch über diese Beteiligungsprojekte hinaus. Und das Ziel ist eben, diese Verzerrungen auszugleichen. Und deswegen gibt es diesen zweiten Schritt. Verstehe.-Und ist dieser Rücklauf, den man da punkto Interesse an der Jury nun hat, ist das einigermaßen repräsentativ? Oder ist das viel, ist das wenig, wenn sich da acht Prozent, bis zu acht Prozent da bereit erklären?-Also es ist immer schwierig, diese verschiedenen Beteiligungsprozesse miteinander zu vergleichen. Aber wenn man sich Zahlen anschaut aus dem internationalen Vergleich, dann ist der Zielwert liegt immer so ungefähr bei plus minus fünf Prozent. Das heißt, in Summe über die bisherigen Beteiligungsprojekte, der zwei Jahre, die schon gelaufen ist als Klimateam, liegt das Klimateam da drüber. Also wir haben, glaube ich, sechseinhalb Prozent ungefähr im Durchschnitt über die einzelnen Bezirke. Es schwankt auch zwischen den Bezirken, sieht man auch. Also es gibt Bezirke, wo knapp unter fünf Prozent die Beteiligung, also die Registrierung der Rücklauf war. Andere Bezirke, wo der Rücklauf über acht Prozent war.-Kann es sein, dass es an der Relevanz des Themas an sich liegt? Oder weil dieser Prozess halt schon den Leuten ein Begriff ist?-Also die individuellen Faktoren, die können wir natürlich nicht erklären, aber es kann unter anderem daran liegen oder auch an der sozietamografischen Struktur im Bezirk. Und wie.-Funktioniert das jetzt bei der Abstimmung, Frau Hertsch, was ich vorher gefragt habe? Müssen diese Juries einstimmig entscheiden oder geht es da um eine einfache Mehrheit? Wie funktioniert das?-Wir starten immer mit einem Auftakt aller Bürgerinnen-Juries aus allen Bezirken. Also aus allen drei Bezirken gibt es einen großen Auftakt-Moment, wo alle Juries zusammenkommen im Rathaus und wir sie auf ihre Aufgabe vorbereiten. Und in dem letzten Jahr, das ist mir halt auch noch so stark bildlich in Erinnerung, das Schöne an diesem Moment ist eben auch, dass wir da einfach Menschen sehen mit sichtbaren Behinderungen, Menschen sehen mit einem sichtbaren Religionsbekenntnis, Menschen sehen mit unterschiedlichen Hautfarben. Und das ist aber auch was sehr Essentliches. Im Rahmen dieser Bildung dieser Jury, dass einfach wir diese Diversität, die wir gesellschaftlich haben, einfach gut adressieren und gut abbilden können. Und auch dann die Menschen, die dann daran teilnehmen, auch einfach sehen, sie sind am richtigen Platz, weil sie sich sozusagen halt irgendwie auch wiedererkennen. Und was passiert dann, wenn sie dann da sind? Eben dieser Auftakt mit diesen drei Juries, da werden die Juries eben auf ihre Rolle vorbereitet. Und was passiert dann in der Jury? Wie erfolgt die Entscheidung? Die Entscheidung basiert auf einem Consent-Prinzip. Also das heißt, die Jurymitglieder werden sozusagen, es entscheidet am Ende nicht die Mehrheit, sondern sie müssen in mehreren Runden sich die Projekte anschauen, darüber verhandeln, sich dazu verständigen. Und dann am Ende gibt es dann halt immer, oder es gibt immer so verschiedene Abstimmungsrunden, wo man sagt, entweder man stimmt dem Projekt zu, man hat ein erheblich, man kann damit leben, das ist sozusagen halt, ja, ist jetzt nicht meine erste, meine Topwahl, meine erste Priorität. Oder es gibt einen erheblichen Widerstand gegen diese Idee. Und immer dann, wenn die erheblichen Widerstände identifiziert werden, dann muss man über die Widerstände sprechen in dieser Gruppe und halt eben die Fragen, die damit verbunden sind, ausräumen bis am Ende, bis man am Ende sozusagen, ich stimme dem zu oder ich kann damit leben.-Aber es wird niemand übergangen.-In Nein, es wird niemand übergangen, nein. Okay.-Und wie viele Projekte werden dann letztlich pro Bezirk ausgesucht? Und die wahrscheinlich wichtigste Frage, wie viel Geld steht dann dafür zur Verfügung?-Am Ende, wie viel dieses Jahr ausgesucht werden, kann man natürlich noch nicht sagen. Es steht und fällt mit der Juryentscheidung ganz grundsätzlich. Wenn man jetzt mal die Jahre zurückgeht und schaut, wie die Juries in den letzten Jahren entschieden haben, dann hatten wir zum Beispiel im sechzehnten Bezirk sind drei Projekte entschieden worden, weil die Jury sich dafür entschieden hat, das Geld, das waren knapp zwei Millionen Euro in Otterkring, die zur Verfügung standen, für Projekte, in Projekte zu investieren mit einem großen Hebel für den Klimaschutz, weil es sozusagen Mobilitätsprojekte sind. Wohingegen im gleichen Jahr der elfte Bezirk mit einem ähnlichen Budget wie Otterkring, glaube ich ein bisschen weniger, sich dafür entschieden haben, elf Projekte auszuwählen, weil sozusagen die Jury sich dann gemeinsam dafür entschieden hat, den Fokus auf jene Projekte zu legen oder einfach das Gut in einem großen Bezirk räumlich gut zu streuen, damit einfach möglichst viele Menschen etwas davon haben. Also das war sozusagen nochmal ein anderes Kriterium, was die Jury sich in dem Kontext erarbeitet hat im Vergleich zum sechzehnten. Mittlerweile stehen wir nach sechs teilgenommenen Bezirken bei über 50 Projekten, die zur Umsetzung durch die Juries vorgeschlagen wurden und die jetzt einfach schrittweise und sukzessive umgesetzt werden.-Und wie geht das dann nach der Entscheidung der Jury mit dem Klimateam generell weiter? Also wenn dann die jetzt ergibt, sagt man okay, diese Projekte finden wir gut oder wir können damit leben. Es fällt eine Entscheidung, ja, das fördern wir, das setzen wir um. Wie geht es dann mit dem Klimateam weiter? Dann kommen die nächsten drei Bezirke dran und dann fängt das wieder von vorne an? Oder was ist so der mittelfristige Plan?-Das Wiener Klimateam ist nach dem Juryentscheid auch in den jeweiligen Bezirken im Grunde noch nicht abgeschlossen. Also es ist zwar der Aktivierungs- und Beteiligungsprozess mehr oder minder abgeschlossen, der sich ja auch fast über ein ganzes Jahr erstreckt, wenn man nochmal schaut von der Ideeneinreichung bis zu dem Moment, wo die Jury zusammenkommt und entscheidet. Und wenn die Jury entschieden hat, für das Budget, was dem Bezirk zur Verfügung steht, zu vergeben für die Projekte, werden diese Projekte wieder der Stadt und den politischen Vertreterinnen übergeben. Und dann sind alle Dienststellen, von denen ich vorher schon gesprochen habe, die uns im Rahmen dieses gesamten Projektes begleiten, angehalten in der jeweiligen Zuständigkeit, so heißt sozusagen, so ist dieser Fachterminus, in der jeweiligen Zuständigkeit, diese Projekte in den nächsten zwei Jahren entsprechend umzusetzen. Und das heißt auch für uns als Büro für Mitwirkung, wo das Wiener Klimateam auch verankert ist, die Umsetzung dieser Projekte noch zu begleiten und zu monitoren. Also wir sind zum Teil natürlich nicht zuständig für die konkrete Umsetzung dieser Projekte, weil dann einfach auch, wenn es etwas im öffentlichen Raum ist, eben andere Dienststellen dafür Verantwortung tragen. Aber wir begleiten das im Sinne des Monitorings, bis diese Projekte entsprechend umgesetzt werden.-Und dann geht es in den nächsten drei Bezirken weiter?-Ja, also nachdem ja die zwei Pilotjahre abgeschlossen sind vom Wiener Klimateam und wir in diesem Jahr schon im ersten offiziellen verstetigten Zyklus laufen, also nicht mehr, nicht mehr im Pilotmodus, ist die politische Absicht zum Ausdruck gekommen, dass es mit diesem Wiener Klimateam-Projekt grundsätzlich weitergeht mit den nächsten Bezirken in den nächsten Jahren.-Ja, wir sind neugierig. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Herzsch und Herr Haslmeier.-Danke für die Einladung.-Zu.-Gast bei Mein Wien Redakteur Bernhard Ichner waren Wenke Herzsch und Martin Haslmeier.